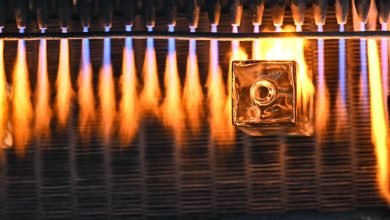Sexkäufe: Hilft das nordische Modell Prostituierten? | ABC-Z

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (beide CDU) haben die Debatte über Prostitution in Deutschland neu angefacht. Klöckner sagte vor Kurzem: „Ich bin fest der Überzeugung: Wir müssen die Prostitution und den Sexkauf hierzulande endlich auch verbieten.“ Warken sprach sich nun für ein Verbot nach dem sogenannten nordischen Modell aus. Was genau bedeutet das? Und: Wirkt es?
Was ist das nordische Modell?
Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes nennt drei Säulen, aus denen das nordische Modell besteht. Diese sind:
1. Die Entkriminalisierung der Prostituierten – der Verkauf sexueller Dienstleistungen ist erlaubt.
2. Die Kriminalisierung der Sexkäufer und Betreiber – der Kauf sexueller Dienstleistungen ist illegal.
3. Die Finanzierung von Ausstiegsprogrammen für Prostituierte, damit diese eine Alternative haben.
Daneben ist laut Terre de Femmes Präventions- und Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit essenziell, um Stigmata abzubauen und den (unfreiwilligen) Einstieg in die Prostitution zu verhindern.
Wo gilt das nordische Modell?
Als erstes Land hat Schweden 1999 ein entsprechendes Gesetz erlassen und damit den Namen geprägt.
In Europa folgten dem Beispiel 2009 Norwegen und Island, 2015 Nordirland, 2016 Frankreich und 2017 Irland. Außerhalb Europas haben 2014 Kanada und 2020 Israel entsprechende Regeln erlassen.
Was sagen die Befürworter des nordischen Modells?
Terre des Femmes setzt sich für die Verbreitung des Modells ein. Laut der Organisation sollten Prostituierte nicht dafür bestraft werden, dass sie sich in einer Zwangslage befinden. Zudem schafften Sexkäufer durch ihre Nachfrage erst den Markt für Prostitution und damit Nährboden für Menschenhandel. Sie sollten deshalb zur Rechenschaft gezogen werden.
Daneben hoffen Befürworter, dass Menschenhandel für sexuelle Ausbeutung durch eine entsprechende Regulierung riskanter für die Täter wird und dadurch abnimmt.
Außerdem soll eine Regelung nach dem nordischen Modell die Geschlechtergleichstellung voranbringen. Denn Prostitution basiere auf hierarchischen und patriarchalen Strukturen: Wenn (zumeist) Männer den Körper von (zumeist) Frauen kaufen könnten, verfestige das Machtstrukturen. So sagte auch Klöckner, mit der deutschen Rechtslage bleibe es bei gewalttätigen Übergriffen, der Übermacht von Männern und bei Unfreiwilligkeit.
Was spricht gegen das nordische Modell?
Zu den Gegnern eines Sexkaufverbots gehört der Berufsverband Sexarbeit. Er kritisiert unter anderem, dass Konzepte und Finanzierung von Ausstiegshilfen in der Realität fehlten. Außerdem gingen die Befürworter davon aus, dass alle in der Prostitution Tätigen aussteigen wollten – was möglicherweise nicht stimmt.
Daneben lasse eine solche Regelung nur die sichtbare Prostitution verschwinden, weil ein Sexkaufverbot alle Beteiligten in den Schattenbereich zwinge. Das eigentliche Ziel des nordischen Modells sei nicht das Wohl der Prostituierten, sondern die Abschaffung der Prostitution.
Ähnlich äußerte sich auch die Diakonie-Bundesvorständin Elke Ronneberger: „Die Erfahrungen aus Ländern mit einem Sexkaufverbot zeigen, dass Prostitution nicht verschwindet, sondern aufgrund des Verbotes von legalen Tätigkeitsorten in gefährliche und prekäre Bereiche abgedrängt wird.“
Kontaktverbote in der Coronazeit hätten laut dem Bundesverband Sexarbeit einen massiven Preisverfall, vermehrte Anfragen nach ungeschütztem Verkehr und verstärkte Gewalt nach sich gezogen. Ähnliches drohe mit einem Sexkaufverbot.
Was ist über die Effektivität des nordischen Modells bekannt?
Mehrere Studien haben in den vergangenen Jahren untersucht, ob das nordische Modell verschiedene Ziele erreicht, etwa eine Eindämmung von Menschenhandel, eine Verbesserung der Situation der Prostituierten und einen Rückgang von Sexkäufen. Dabei ist es teilweise schwierig, an belastbare Daten zu kommen – etwa weil Menschen wahrscheinlich weniger offen zugeben, Sex zu kaufen, wenn es illegal ist. Zudem zeigen die Studien teilweise nur zeitliche Zusammenhänge auf, aber keine kausalen.
Die Untersuchungen zeigen, dass die Auswirkungen in verschiedenen Bereichen unterschiedlich ausfallen und es teilweise negative Nebeneffekte geben kann. Die Effekte des nordischen Modells hängen zudem von der Ausgangslage ab: War Prostitution zuvor legal oder illegal?
Dämmt das nordische Modell Menschenhandel ein?
Vor Kurzem wurde eine Studie über die Auswirkung des nordischen Modells auf den Menschenhandel in Schweden, Norwegen und Frankreich an Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) übergeben. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Einführung des Modells „auch langfristig zu einer objektiv messbaren Reduzierung der Anzahl an Menschenhandelsopfern“ beitrage. Das liege etwa an verbesserten Arbeitsmethoden der Polizei und daran, dass Täter in Fällen, in denen die Beweislage für Menschenhandel schwierig ist, stattdessen für Zuhälterei verfolgt werden können.
Eine entsprechende Regulierung „stärkt die Rechtsposition von Prostituierten unter anderem dadurch, dass sie de jure als Opfer von Ausbeutung anerkannt werden“ und sich dadurch „nachweislich häufiger an die Strafverfolgungsbehörden“ wenden. Durch das erhöhte Risiko lohnten sich Menschenhandel und Zwangsprostitution zudem weniger für die Täter.
Allerdings sei durch solche Regelungen eine Verlagerung der Prostitution ins Internet zu beobachten.
Zuvor kam eine Untersuchung über die Situation in Norwegen und Schweden zu dem Schluss, dass Menschenhandel mit einer härteren Gesetzgebung gegen Prostitution abnimmt. Wenn Prostitution illegal ist, gibt es demnach die wenigsten Fälle, mehr gibt es im nordischen Modell, und besonders verbreitet ist Menschenhandel, wenn Prostitution legal ist.
Verbessert das nordische Modell die Situation der Prostituierten?
Die Diakonie hat verschiedene Metaanalysen zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen von Prostituierten in verschiedenen rechtlichen Regelungen zusammengestellt. Eine Metaanalyse von Studien im EU-Raum zeigte demnach, dass eine Kriminalisierung von Sexkäufen dazu führt, dass „sich Zugang zu sicheren Arbeitsorten, die Beziehung zu Kund:innen sowie die Wohnsituation von Sexarbeiter:innen verschlechtert und die Preise fast immer verringert“ haben.
Auch in Kanada hat die Einführung des nordischen Modells die Situation der Prostituierten nach einer anderen Analyse nicht verbessert. Stattdessen berichteten die Prostituierten von einem höheren Gewaltrisiko durch Kunden. Zudem seien die Prostituierten zu längeren Arbeitszeiten und in ein riskanteres Arbeitsumfeld gezwungen, da sie nach wie vor gleich viel verdienen müssten.
Mehrere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass durch die Kriminalisierung von Sexkäufen die Gewalt gegen andere Frauen zunehme. So zeigen zwei Untersuchungen, dass in Schweden nach der Einführung die häusliche Gewalt gestiegen ist. Eine länderübergreifende Untersuchung in Europa zeigte, dass Vergewaltigungen zunehmen, wenn der Zugang zu käuflichem Sex erschwert wird; wird er erleichtert, nimmt sexuelle Gewalt ab, allerdings in einem geringeren Maß.
Nehmen Sexkäufe durch das nordische Modell ab?
Studien in Großbritannien und Schweden haben keine Hinweise darauf gefunden, dass durch die Kriminalisierung von Freiern weniger sexuelle Dienstleistungen gekauft werden. In Großbritannien stieg die Zahl sogar leicht an, die Klientel verschob sich aber zu risikofreudigeren Käufern.
Eine nicht repräsentative Umfrage unter 96 Freiern in Deutschland ergab, dass diese am ehesten durch einen Eintrag in ein Verzeichnis von Sexualstraftätern vom Kauf sexueller Dienstleistungen abgehalten würden. Außerdem würde es sie abschrecken, wenn ihr Name öffentlich bekannt gemacht würde und ihnen eine Gefängnisstrafe drohen würde. Weitere, höhere strafrechtliche Sanktionen landeten auf Platz sieben von zwölf möglichen Konsequenzen. Ob die Einführung des nordischen Modells zu einer Abnahme von Sexkäufen führt, könnte also von der Art der Strafen abhängen.