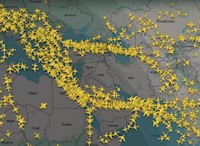Schwarz-Roter Koalitionsvertrag: So teuer sind die Pläne von Union und SPD | ABC-Z

Lange haben Union und SPD verhandelt, um sich in Finanzfragen
zu einigen. Und am Ende heißt es im Koalitionsvertrag: Alle Maßnahmen stehen
unter Finanzierungsvorbehalt. Bei genauerem Blick in
das 144 Seiten lange Dokument zeigt sich jedoch: Dafür gibt es gute
Gründe.
Viele enorm kostspielige Vorhaben haben es in den Vertrag geschafft. Die
wichtigsten, zum Beispiel Steuersenkungen für Unternehmen und Entlastungen bei den Stromkosten, könnten zusammengenommen rund 54
Milliarden Euro kosten, wie Berechnungen des Steuerexperten Stefan Bach
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigen. Ob sich alles bezahlen lässt, ist äußerst fraglich. Denn die Sparanstrengungen von Union und SPD etwa beim Bürgergeld oder in der Verwaltung sind überschaubar. Und von der SPD angestrebte Steuererhöhungen für Besserverdiener oder Vermögende, durch die der Bund mehr einnehmen könnte, sind am Widerstand der Union gescheitert.
Vor allem die Steuergeschenke fallen ins Gewicht. Die geplante
Senkung der Stromsteuer dürfte 10,5 Milliarden Euro Mindereinnahmen bedeuten, schätzt Bach. Die
Senkung der Körperschaftssteuer 18 Milliarden. Die Ausweitung der von der CSU durchgesetzten Mütterrente etwa fünf Milliarden. Die niedrigere Mehrwertsteuer für die
Gastronomie bedeutet demnach mehr als vier Milliarden Euro Mindereinnahme.
Dazu kommen unter anderem die Kaufförderung von
Elektroautos, der wieder subventionierte Agrardiesel für Landwirte, die Erhöhung der Pendlerpauschale.
Die Kosten
für eine mögliche steuerliche Entlastung von Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen
bei der Einkommenssteuer hat Bach noch gar nicht einberechnet. Auch davon ist
im Koalitionsvertrag die Rede, allerdings, ohne dass Details genannt werden. Eine solche Reform soll erst zur Mitte der Wahlperiode kommen.
Schon die Vorgängerregierung hatte kaum finanziellen Spielraum. Die Ampel-Koalition scheiterte schließlich daran, Milliardenlücken im Haushalt zu schließen und sich auf einen Etat
für das laufende Jahr zu einigen.
Mit der kürzlich beschlossenen Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben
und dem 500-Milliarden-Sondervermögen für die Sanierung maroder Infrastruktur haben sich die künftigen Regierungspartner Union und SPD zwar
etwas Luft verschafft. Dennoch ist der zusätzliche Spielraum im Kernhaushalt des Bundes gering. Auch weil die Grünen dafür gesorgt
haben, dass der Bund das Geld für die Infrastruktur nicht für andere Vorhaben abzwacken darf, sondern nur für zusätzliche Projekte ausgeben.
Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags bemühten sich
Union und SPD zu betonen, dass man auch sparen werde. Das beschriebene Sparpotenzial beschränkt sich jedoch aufs Bürgergeld, das etwa neu ankommende Ukrainer nicht mehr bekommen sollen, oder in der Verwaltung. Die Sparpläne gehen Ökonomen zufolge nicht weit genug, um die angekündigten Vorhaben zu finanzieren. Stefan
Bach geht davon aus, dass sich beim Bürgergeld nur wenige Milliarden Euro einsparen lassen. In der Verwaltung sehe es ähnlich aus, zumindest kurzfristig. Die Union
habe sich mit der Tabuisierung von Steuererhöhungen “ideologisch eingegraben”, kritisiert Bach. “Das
funktioniert nicht, wenn man bei Ausgabenkürzungen nicht liefert.”
Trübe Wachstumsaussichten
Aus Sicht von Ökonomen könnte die Regierung
durch Kürzungen Milliarden einsparen. Großen Spielraum sehen sie unter anderem beim Abbau von klimaschädlichen Subventionen, der Streichung
von Steuerprivilegien für Vermögende, einer Reform des Ehegattensplittings,
aber auch bei Kürzungen von Leistungen wie dem Elterngeld.
Ob die Rechnung von Schwarz-Rot aufgeht, hängt von einigen unsicheren Faktoren ab, unter anderem davon, wie sich das Wirtschaftswachstum und damit die Steuereinnahmen entwickeln. Zumindest für einige der kostspieligeren Vorhaben wollen sich Union und SPD mehr Zeit nehmen: Ähnlich wie die
Einkommenssteuerreform soll die Körperschaftssteuer erst ab 2028
sinken. Ob die Wirtschaft bis dahin wieder in Schwung kommt, wird auch davon abhängen, ob die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung
greift. Also ob es tatsächlich gelingt, für mehr private Investitionen zu
sorgen, die Beschäftigung zu erhöhen und Bürokratie abzubauen, wie von den
Parteien versprochen.
Derzeit sind die Aussichten weniger gut: Für das laufende Jahr haben die führenden Wirtschaftsinstitute
des Landes ihre Wachstumserwartungen drastisch gesenkt. Zusätzliche Sorgen bereiten Ökonomen die Folgen der schwer berechenbaren Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump für die Konjunktur.
Der vollumfängliche Finanzierungsvorbehalt im
Koalitionsvertrag ergibt also durchaus Sinn. Auch hinsichtlich der Glaubwürdigkeit
der Parteien. Nachdem vor allem die Union, aber auch die SPD wegen der riesigen Schuldenpakete für Verteidigung und Infrastruktur zuletzt
viel Kritik einstecken mussten, sind die Parteien bemüht, ihre Finanzpolitik als
seriös erscheinen zu lassen. Die Formulierung im Koalitionsvertrag könnte dabei
helfen.