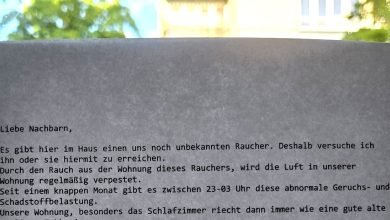Berlin
Matchwinner: Matt Thomas: 102:88! Alba besiegt Bonn und ist den Playoffs nah | ABC-Z

Matt Thomas hat Alba Berlin auf einen Platz in den Play-Ins der Basketball-Bundesliga geführt. Im 93. Liga-Duell gegen die Telekom Baskets Bonn erzielte der 30 Jahre alte US-Amerikaner beim 102:88 (52:41)-Sieg in der Uber Arena mit 34 Zählern das beste Punktergebnis seiner Karriere.