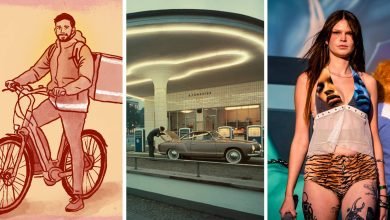Proteste in Frankreich: Jahrzehnte Politik jenseits der Realität | ABC-Z

Frankreich steht vor einer Stunde der Wahrheit. Wie 1945 muss es sich zwischen Modernisierung und Deklassierung entscheiden“, schreibt der Pariser Historiker und Ökonom Nicolas Baverez in einem im vergangenen Jahr erschienenen Buch „Sursaut“ (Schreckmoment). Der Autor, der seit Jahrzehnten aus einer liberalen Perspektive vor einem Niedergang Frankreichs warnt, verwendet gerne klare Worte. Frankreich vereine eine autoritäre und machtlose präsidiale Monarchie, einen aufgeblähten und zerstörerischen Staat, eine kreditfinanzierte Abwärtsspirale und eine zersplitterte Gesellschaft, fasst Baverez zusammen. Und er ergänzt: „Wenn ein Land zusammenbricht, gibt es einen tragikomischen Moment, in dem alles, was es retten könnte, bekämpft wird, und alles, was es zum Scheitern verurteilt, gefördert und unterstützt wird.“
Die von Charles de Gaulle vor 57 Jahren geschmiedete Fünfte Republik ist schon häufig und zu Unrecht totgesagt und -geschrieben worden. Auch droht Frankreich aktuell kein Zusammenbruch. Aber Umfragen, die in der Bevölkerung eine zunehmende Demokratiemüdigkeit erkennen lassen, sprechen neben einem unverkennbaren Überdruss über einen in seiner letzten Amtsperiode befindlichen Staatspräsidenten und die chronisch zerstrittenen Vertreter der das Land über Jahrzehnte regierenden gemäßigten Linken und Rechten für wachsende Zweifel an den Grundlagen der Fünften Republik.
Deren Gründer hatte keine Situation vorhergesehen, in der ein Staatspräsident ohne Mehrheit in der Nationalversammlung in zwei Jahren fünf Premierminister ernennt – ohne Aussicht auf eine stabile Regierung. So lässt sich kein Land steuern; erst recht nicht in schwierigen Zeiten. Andererseits ist eine breite Fluchtbewegung der Bevölkerung aus den Traditionen der Fünften Republik aktuell ebenso wenig erkennbar. Nach Umfragen würden die Rechtspopulisten vom Rassemblement National (ehemals Front National) bei Neuwahlen mit 33 Prozent wieder die stärkste Partei. Aber gegenüber der vorangegangenen Wahl bedeuteten 33 Prozent eine Stagnation und keinen Fortschritt. Und die Linkspopulisten um Jean-Luc Mélenchon haben ihre beste Zeit offenbar hinter sich. Trotz gelegentlicher öffentlicher Proteste wie am Donnerstag scheint politischer Mehltau auf dem Land zu liegen.
Ein Niedergang in Zeitlupe
Der wirtschaftliche Niedergang Frankreichs, den Baverez schon vor über 20 Jahren in einem Buch („La France qui tombe“) thematisierte, wurde von vielen Menschen lange verdrängt, weil er wie in Zeitlupe verlief. Aber er lässt sich heute an einer Vielzahl von Indikatoren erkennen. Letztmals erzielte der französische Staat im Jahr 1973 einen Haushaltsüberschuss. Seit mehr als einem halben Jahrhundert folgte in guten wie in schlechten Zeiten ein Haushaltsdefizit.
Das Problem Frankreichs bestand nicht in schuldenfinanzierter Finanzpolitik in schwierigen Phasen wie der Finanz- und Eurokrise oder der Pandemie. Eine solche Politik wurde in vielen Ländern betrieben. Das Problem bestand, anders als im Deutschland der Schuldenbremse, in der Weigerung gemäßigt linker wie rechter Regierungen, in wirtschaftlich besseren Zeiten finanzpolitisch vernehmlich auf die Bremse zu treten. Denn keine Regierung traute sich über Jahrzehnte, der Bevölkerung zu sagen, wie sehr Frankreich über seine Verhältnisse lebt.
Einen untrüglichen Indikator für das Leben über seinen Verhältnissen bildet die Verwendung von Staatsschulden zur Finanzierung laufender Konsumausgaben. Dann leben aktuelle auf Kosten künftiger Generationen. Das ist in Frankreich seit Jahrzehnten gängige Praxis. „Die erheblichen Defizite der französischen Sozialkassen erklären einen Großteil der Anhäufung einer erdrückenden Verschuldung, die unsere Souveränität bedroht“, schreibt der Manager und Autor Nicolas Dufourcq in einem Mitte Oktober erscheinenden Buch über den Sozialstaat („La Dette sociale de la France“).
Die Einsparpotentiale sind erheblich
Nach Berechnungen der Banque de France lag 2023 der Anteil der Staatsausgaben mit 57 Prozent an der Wirtschaftsleistung deutlich über dem Durchschnitt der westlichen Industrienationen. Der französische Aufschlag erklärt sich überwiegend mit überdurchschnittlich hohen Staatsausgaben für Rente und Gesundheit. Eine rund zwei Jahre alte Studie aus dem Internationalen Währungsfonds zeigt zudem eine ineffiziente Organisation eines Staates, der sein Geld viel effizienter einsetzen könnte. Die Einsparpotentiale sind erheblich. „Ausgabereformen sind erforderlich, um den Trend steigender Staatsausgaben umzukehren und wieder finanzpolitischen Puffer aufzubauen“, mahnt der Fonds.
Rentendebatten verlaufen in alternden Gesellschaften besonders schwierig; das gilt auch für Deutschland. In Frankreich sind sie noch heikler. Anfang der Achtzigerjahre, als in anderen Ländern moderat rechte Regierungen einen überbordenden Staatseinfluss auf die Wirtschaft zurückdrängten, senkte in Paris eine sozialistisch-kommunistische Regierung in einem breit angelegten Versuch, das Land in kurzer Zeit zu ruinieren, das gesetzliche Rentenalter auf 60 Jahre. Daneben existierte schon zuvor eine Vielzahl spezieller Vereinbarungen für Institutionen besonders des öffentlichen Dienstes, deren Beschäftigte zum Teil als Mittfünfziger mit vollem Rentenanspruch aus dem Beruf scheiden konnten.
Diese Sonderregelungen („régimes spéciaux“) hat die Politik mittlerweile reduziert, aber nicht abgeschafft. Das gesetzliche Rentenalter wurde zwischenzeitlich auf 62 Jahre heraufgesetzt, aber die 2023 beschlossene schrittweise Erhöhung auf 64 Jahre wollen die Linksparteien wieder rückgängig machen. Einmal vom Staat gewährte soziale Errungenschaften („acquis sociaux“) werden unabhängig von ihrer Finanzierbarkeit mit Zähnen und Klauen verteidigt. Über Jahrzehnte wollte sich keine Regierung mit einer Kürzung der Staatsausgaben unbeliebt machen. Stattdessen wurden zur Ausgabenfinanzierung die Staatsschulden, aber auch Steuern erhöht.
Geschrumpfter Industrieanteil
Diese Politik untergrub allmählich das wirtschaftliche Fundament des Landes. In keiner anderen bedeutenden traditionellen Industrienation ist in den vergangenen Jahrzehnten der Anteil der Industrie an der Wirtschaftsleistung so stark geschrumpft wie in Frankreich. Dort beträgt er nur noch neun Prozent. Das ist weniger als die Hälfte des deutschen Anteils, aber auch gegenüber Italien sieht Frankreich schlecht aus. Der Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Vergleich zur Wirtschaftsleistung ist ebenfalls unterdurchschnittlich; die Zunahme der Produktivität beeindruckt seit geraumer Zeit wenig.
Die Arbeitslosenquote hält sich seit mehr als einem halben Jahrhundert über sieben Prozent, womit Frankreich deutlich schlechter abschneidet als etwa Deutschland. Überdurchschnittlich hoch verharrt besonders die Arbeitslosigkeit unter jüngeren Menschen. Umgekehrt liegt die Beschäftigungsquote, das ist der Anteil der Beschäftigten an der arbeitsfähigen Bevölkerung, in Frankreich niedriger als in anderen Ländern. Auch in der Zahl der durchschnittlichen Arbeitsstunden im Jahr befindet sich Frankreich im unteren Teil der Tabelle. Zusammengefasst: Frankreich bleibt seit vielen Jahren weit unter seinem wirtschaftlichen Potential.
Sichtbarer wurde der Niedergang seit der Einführung der Währungsunion, in deren Vorfeld die 1997 zu ihrer Überraschung an die Macht gekommene Linke mit der Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 39 auf 35 Stunden mit Lohnausgleich einen historischen Fehler beging. Als sich andere Teilnehmer an der Währungsunion wirtschaftlich fit zu machen versuchten, band sich Frankreich mit einer nachhaltigen Verteuerung der Produktionskosten einen Klotz ans Bein. Die Sozialisten hatten, von Neuwahlen überrascht, die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche ohne langes Nachdenken in ihr Programm geschrieben. Nach dem Wahlsieg sahen sie sich gezwungen, den Worten Taten folgen zu lassen, obgleich führende Vertreter ein mulmiges Gefühl hatten.
Hilflose Versuche
Verständnis für die Notwendigkeit einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft war nicht nur auf der Linken ein arg knappes Gut. Frankreich habe mit der Einführung des Euros einen politischen Sieg erzielt, aber wirtschaftlich von allen Mitgliedern am wenigsten vom Euro profitiert, schrieb Dufourcq vor rund zwei Jahren in einem Buch über den Niedergang der Industrie („La désindustrialisation de la France“). Als Gründe nannte er neben der 35-Stunden-Woche ein jahrzehntelanges Versagen von Links- wie Rechtsregierungen, die aus Angst vor sozialen Spannungen und politischer Radikalisierung den Sozialstaat auf Kosten gesunder Staatsfinanzen ausbauten.
Heute sind hilflose Versuche vernehmbar, wirtschaftliche Logik in schicksalhafte Verstrickung umzudeuten. „Die doppelte Falle des Euros hat sich für die Franzosen geschlossen“, deklamiert Jean Pierre Robin, ein langjähriger wirtschaftspolitischer Kolumnist der Zeitung „Le Figaro“. Er fährt fort: „Die Gemeinschaftswährung hat eine übermäßige Verschuldung ermöglicht. Heute ist es unmöglich, sie abzuwerten, um die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen.“ Mit der Aufgabe des Franc, den Frankreich zwischen 1944 und 1987 dreizehnmal abwertete, hätten die Franzosen nach der Deutschen Mark, „der Matrix des Euros“, gegriffen und „diese starke Währung, die ihnen phantastische Perspektiven bot“, missbraucht.
Die Banque de France betrachtet den Euro jedoch nicht als Sündenbock, sondern eher als Segen. Von der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank profitiere Frankreich im Besonderen, bemerkte im vergangenen Jahr mit der Ökonomin Agnès Bénassy-Quéré ein Führungsmitglied der Notenbank. Sie erinnerte daran, dass seit der Gründung der Währungsunion die Kaufkraft pro Kopf in Frankreich um 26 Prozent gegenüber nur 17 Prozent im Durchschnitt der Eurozone gestiegen sei. Und während zu Zeiten des Franc zwischen 1980 und 1998 die durchschnittliche Inflationsrate 4,4 Prozent betragen habe, sei sie seit der Einführung des Euros auf einen Durchschnittswert von 1,9 Prozent gefallen.
Macrons „goldene Dekade“?
Nach seinem ersten Wahlsieg im Frühjahr 2017 hatte Emmanuel Macron mit dem Schwung der Jugend versucht, das durch interne Blockaden gelähmte Land wirtschaftspolitisch auf Vordermann zu bringen. Mit seiner in der Mitte des politischen Spektrums angesiedelten Bewegung „En Marche“ war es ihm gelungen, die über Jahrzehnte dominierenden Parteien der gemäßigten Linken und Rechten zu marginalisieren. Macrons Ankündigung, die Angebotsbedingungen der französischen Wirtschaft endlich nachhaltig zu verbessern, darunter eine Reform des verkrusteten Arbeitsmarkts, veranlasste Holger Schmieding, den Chef-Volkswirt von Berenberg, für Frankreich „eine goldene Dekade“ anzukündigen.
„Über sieben Jahre lang ging diese Kalkulation auf. Das Wachstum in Frankreich lag in der Regel über dem Durchschnitt der Eurozone (ohne das volatile Irland)“, schreibt Schmieding im Rückblick. „Vor allem dank der weiteren Reformen, die er als Präsident in seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2022 vorangetrieben hat, wurden in Frankreich bis Herbst 2024 deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als in Deutschland.“ Macrons „großer Fehler“ sei die unnötige Ankündigung von Neuwahlen für die Nationalversammlung im vergangenen Jahr gewesen, nach der keines der drei Lager – Linke, Zentristen und Rechtspopulisten – über eine Mehrheit verfüge.
Macron war jedoch schon vor den Parlamentswahlen in Schwierigkeiten geraten, weil er die entschiedenen Widerstände gegen seine Reformpolitik, etwa durch die Bewegung der Gelbwesten, nur durch zusätzliche Staatsausgaben und damit durch einen weiteren Anstieg der Verschuldung dämpfen konnte. So steht Macrons Präsidentschaft sowohl für eine mutige, wenn auch unvollständige Reformpolitik, aber auch für eine weitgehend ohne Disziplin betriebene Verschuldung. Die ohnehin in Frankreich starken Vorbehalte gegenüber Liberalisierung und Globalisierung haben in den vergangenen Jahren noch einmal zugenommen.
Immerhin hat spätestens mit der Herababsetzung des Ratings durch die Agentur Fitch das beunruhigende Niveau der Staatsverschuldung die Öffentlichkeit erreicht. Doch weil deutliche Kürzungen der Staatsausgaben immer noch nicht mehrheitsfähig sind, suchen die Parteien nach Möglichkeiten, die ohnehin schon hohe Steuerlast noch weiter zu erhöhen. So begeistert sich die Linke für die nach einem Ökonomen benannte „Zucman-Steuer“, die Vermögen ab 100 Millionen Euro mit einem Satz von zwei Prozent erfassen soll. Die Schätzungen über das Aufkommen reichen von weniger als fünf Milliarden bis 25 Milliarden Euro. „Die Wahrheit ist, dass es keine schmerzlosen Steuern gibt, ebenso wenig wie magische Steuern, die in Frankreich enorme Einnahmen bringen würden, während sie bei unseren Konkurrenten nicht gelten“, warnt der Gouverneur der Banque de France, François Villeroy de Galhau, mit Blick auf eine Auswanderung erfolgreicher Unternehmer, die das Land dringend benötigt.
„Politik kann man nur auf der Grundlage von Realitäten machen“
Auch andere Vorschläge lösen das finanzpolitische Problem nicht im Kern. Die Versprechungen der Rechtspopulisten einer deutlichen Senkung der Staatsausgaben durch Kürzungen bei den Ausgaben für Immigration dürften nach oben aufgerundet sein, während die Linkspopulisten die von der Banque de France gehaltenen Staatsanleihen streichen und die Abhängigkeit von ausländischen Käufern von Staatsanleihen durch eine stärkere Mobilisierung inländischer Gelder für den Staat reduzieren wollen. Für den Umgang mit der Staatsverschuldung scheint der alte Satz zu gelten: Es muss wohl erst noch schlechter werden, eventuell bis zum ersten Aufflackern einer ernsten Schuldenkrise, ehe es besser werden kann.
Für Baverez, den Mahner und Warner, steht unverdrossen fest: Frankreich kann es schaffen. „Frankreich zeichnet sich durch eine Abfolge extremer Situationen aus, in denen sich schwindelerregende Höhen und Tiefen abwechseln“, erinnert der Historiker. „Es erholt sich, strahlt, wird schwächer, fällt und steht wieder auf. Es zeigt abwechselnd Stolz, Größe, Sorglosigkeit, Verzicht, Resignation und Wiederaufleben.“
Allerdings existiere keine Garantie für den Wiederaufstieg aus der aktuellen Krise: „Die hartnäckige Vorstellung, dass Frankreich eine Großmacht bleibt, unantastbar und immun gegen finanzielle, soziale, politische oder strategische Erschütterungen, ist völlig falsch.“ Für ihn benötigt die Politik jetzt eine Entschlusskraft, die sie über Jahrzehnte vermissen ließ. Im Schlusskapitel zitiert Baverez Charles de Gaulle: „Man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind, denn Politik kann man nur auf der Grundlage von Realitäten machen.“ Diese Lektion gilt nicht nur für Frankreich.