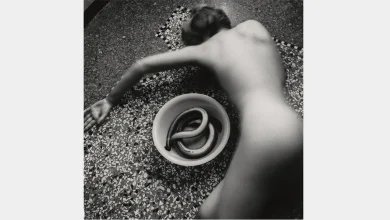Peter von Matt: Immer den murmelnden Globus im Ohr | ABC-Z

Ein
Mensch, der wie Peter von Matt einen großen Teil seines Lebens in Bibliotheken
verbracht hat, ist am Ende seines Lebens ein gelassener Mensch. Er kennt jede
Intrige, jeden Krieg, jeden größenwahnsinnigen Führer aus der Geschichte der
Menschheit. Gelassen, das war der große Schweizer Germanist
und Literaturerzähler Peter von Matt, der am Ostermontag im Alter von 87 Jahren
in Zürich gestorben ist. Und diese Gelassenheit war dabei nie mit Überdruss,
Langeweile oder einem greisenhaften Alleskennen zu verwechseln.
Nein, nein, er war neugierig und wissensdurstig und leseenthusiastisch bis
zuletzt. Und er war ein großzügiger Denker, der das Wissen, das er seiner
lebenslangen Lektüre verdankte, mit vollen Händen an jeden verteilte, der ihn
danach fragte.
Der
Literaturkritiker, sein Freund Marcel Reich-Ranicki aus dem fernen Frankfurt, hat ihn einmal “den
besten Erzähler der Schweiz” genannt. Damit hat er von Matt keinen sehr großen
Gefallen getan, die Schweizer Schriftsteller wollten sich durchaus nicht von
einem Germanisten in ihrem ureigenen Fachgebiet übertrumpfen lassen. Er selbst
hat das auch brüsk zurückgewiesen. Er müsse schließlich jeden dritten Satz
nachschlagen. Er sei Wissenschaftler, auf die Werke der Schriftsteller
angewiesen, um seine Arbeit zu tun. Aus ihm selbst, aus seiner Fantasie, könne
er nur wenig schöpfen. “Ich schreibe nichts aus dem Bauch heraus”, sagte er
einmal. Aber es war natürlich auch etwas dran, an Reich-Ranickis Lob. Der
leidenschaftliche Lehrer und berühmte Ordinarius für deutsche Literatur an der
Universität Zürich konnte die Literatur, mit der er sich beschäftigte, und
seine Forschungsergebnisse darüber glänzend erzählen.
Er
hat über Grillparzer promoviert, hatte sich im Studium der Anglistik und
Amerikanistik viel mit Virginia Woolf und Edgar Allan Poe beschäftigt und große
Teile seines Professorenlebens aber mit der zeitgenössischen, der lebendigen
deutschen Literatur, vor allem auch der der Schweiz beschäftigt. An der
Universität war er ein Star, viele Studierende kamen nur seinetwegen hierher. Er
trat regelmäßig in Reich-Ranickis Literarischen Quartett auf, sein Schweizer
Idiom war sanft, angenehm und ließ noch seine harten Urteile weich und
freundlich klingen. Er konnte auch sehr direkt sein. Die erste Frage, die er
Marcel Reich-Ranicki in einem später auf 200 Buchseiten angeschwollenen
Gespräch stellte, lautete: “Sind Sie grausam?” – als habe er selbst ein wenig
Angst vor den mitunter brutalen Urteilen des deutschen Kritikers, die wie ein
Fallbeil ein Werk in zwei Teile spalten konnten.
Peter
von Matt hatte auch ein großes Talent zur Freundschaft. Er war ein geselliger
Mensch, wanderte gern und sah sich auch in seinen literarischen Urteilen nicht
durch die Freundschaft mit zeitgenössischen Autoren getrübt. Von dem
altergermanistischen Dogma, man müsse Autor und Werk streng voneinander trennen
und die Person des Autors sei überhaupt uninteressant, hielt er überhaupt
nichts. “Ich bin überzeugt, dass ich das prachtvolle Buch nur ganz verstehe, wenn
ich über den Autor unterrichtet bin, und je besser ich über ihn unterrichtet
bin, um so besser, glaube ich, verstehe ich das Buch”, schrieb er in seinem
Essay Ihr guten Leute und schlechten Musikanten. Besonders schön in diesem
Satz – das eingestreute “glaube ich”. Peter von Matt verbarg seine
Unsicherheiten selten hinter einer Mauer aus Eindeutigkeiten. Das Schwanken
gehörte für ihn immer mit dazu. Und es machte sein Schreiben lebendig. Übrigens
waren natürlich nicht alle Schriftsteller für ihn interessant: “Die Person
eines Autors interessiert mich nur dann, wenn er ein großartiges Buch
geschrieben hat.”
Mit
Max Frisch war er am besten befreundet. Mit ihm teilte er den lebenslangen
Kampf gegen letzte Gewissheiten. Im Ringen von Frischs Bildhauer Stiller gegen den
Zwang der Gesellschaft, ein Leben lang jener Stiller bleiben zu müssen,
erkannte von Matt sein eigenes Ringen um Lebendigkeit und Offenheit: “Anatol Stiller,
der tobende und schluchzende Neurotiker, ist in Wahrheit keine Psychostudie,
sondern führt exemplarisch die Qualen dessen vor, der lebendig bleiben will in
einer verhärteten Welt.” Peter von Matt hat diesen Stiller auch als ein
politisches Ideal oder eine Art Vorbild betrachtet für den Kampf, den er lange
Zeit um und mit und für die Schweiz führte. Er hoffte, dass die neutrale
Schweiz zwischen den verhärteten Machtblöcken der Welt ein Labor sein könnte
für gute, neue Zukunftsvisionen einer besseren Welt. Da sah er sich lange auch
mit dem politischen Max Frisch einig.
Überhaupt
war ihm unbedingt Zeitgenossenschaft wichtig. Trivialliteratur, Liveticker,
Trash-TV, X und TikTok, alles, alles, alles ging ihn an. “Das freie, eigene
Denken verlangt den offenen Blick in den Mahlstrom des Mainstreams, in die
Produktion der Saisonüberzeugungen und die weltweiten Rituale des Nachbetens.
Die Stille, die zum eigenen Denken gehört, gewinnt nur, wem der murmelnde
Globus in den Ohren dröhnt”, schrieb er in seinem Essay Lesen als
Katastrophe. Dass man, um das alles zu verstehen, zu deuten und zu bewältigen,
aber selbstverständlich immer der Bibliothek als Rückzugsort und
Gegenmacht bedarf, das war für Peter von Matt natürlich eine Selbstverständlichkeit. Mit welcher Freude zitierte er
Plutarch, der über die offene Bibliothek des Lucullus schrieb: “Seine
Bibliothek blieb nämlich immer offen, die Gänge und Lesesäle frei zugänglich
für alle Griechen, welche denn auch entzückt von ihren übrigen Beschäftigungen
abließen und dorthin eilten wie zum Wohnsitz der Musen.”
Peter von Matt liebte zu lesen und liebte den Umgang mit den Autoren. Wie begeistert
schildert er einmal, wie ihm der jüngst verstorbene Peter Bichsel die Kunst des
Schlangen-Fangens beibrachte und Max Frisch in seiner Wohnung seine
Meisterschaft in der Skitechnik des Telemarks demonstrierte. Von Matt erkannte
in beiden von den Autoren stolz demonstrierten irdischen Künsten ein Muster
für ihre literarischen Techniken der Genauigkeit und Behutsamkeit.
Doch
die wahre Arbeit des Germanisten beginnt erst mit dem Tod der Autoren. “Wenn
große Dichter tot sind, geben sie zu tun”, hat er nach dem Tod von Max Frisch
geschrieben. Und in dem Text beschreibt er erst mal anschaulich das herrliche
Beerdigungsritual des Autors von Montauk und Homo faber und von Andorra.
Wie er selbst glaubte, seine Beerdigung minutiös planen zu können, obwohl er
doch noch gar keine Erfahrung damit hatte. “Ich weiß nöd, wie me stirbt”, habe
er gesagt und dann doch seine genauen Anweisungen gegeben, als plane er die
perfekte Telemark-Landung beim Skifliegen. Und wie es dann doch völlig anders
gekommen ist als geplant, als seine Freunde “getrunken, kräftig getrunken”
hatten im Garten vor seinem Haus in Bellinzona und um ein Feuer saßen und
schließlich ein Bühnenbildner kam, die Urne unter dem Arm, und anfing, die Asche
des Dichters ins Feuer zu streuen und einer nach dem anderen in die Urne griff
und etwas Asche ins Feuer warf. “Wurf um Wurf, langsam, feierlich und fröhlich,
wehte die Asche des Dichters erneut in das prasselnde Element und tanzte in den
Flammen und schoss mit ihnen hinauf zum lautlosen, schwarzen Himmel.”
Die
letzte Befreiung des freiheitsliebenden Max Frisch. Doch für den Germanisten –
fängt mit dem Tod die Arbeit an. “Die Hauptarbeit, die nach einem solchen Tod
beginnt, ist jene, die Max Frisch selbst uns verboten hat. Es muss ein Bildnis
gemacht werden”, schreibt von Matt, “das endgültige. Das ist ein spannender
Vorgang, der die genaue Beobachtung lohnt und den man nicht laufen lassen darf,
wie er eben läuft.” Es gilt nun, das Wesentliche zu finden und zu beschreiben.
Das, was bleiben soll. Und vor allem: das endgültige Verschwinden zu
verhindern: “Das Vergessen und die Vergemütlichung sind gleicherweise
katastrophal. Man kann sie verhindern, aber das gibt zu tun.”
Nun
ist auch sein eigenes Werk vollendet. Und es beginnt die Arbeit der Lebenden am
erzählerischen Werk des wundervollen, großen Germanisten Peter von Matts, der
am selben Tag wie der Papst gestorben ist. Er selbst hätte sich nie als
Literaturpapst bezeichnen lassen. Das war ja schon sein im Jahr 2013
gestorbener Frankfurter Freund. Dabei hätte ihm der Titel ganz gut gestanden.
Ein menschenfreundlicher Gegenpapst aus der Schweiz, der eigenen Fehlbarkeit
stets gewiss.