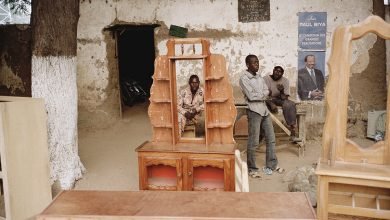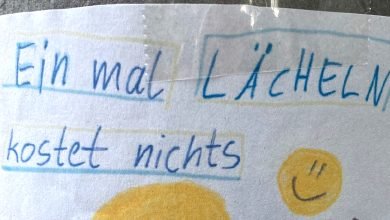Otrovertiert statt zugeknöpft? Neuer Persönlichkeitstyp stellt alte Kategorien infrage | ABC-Z
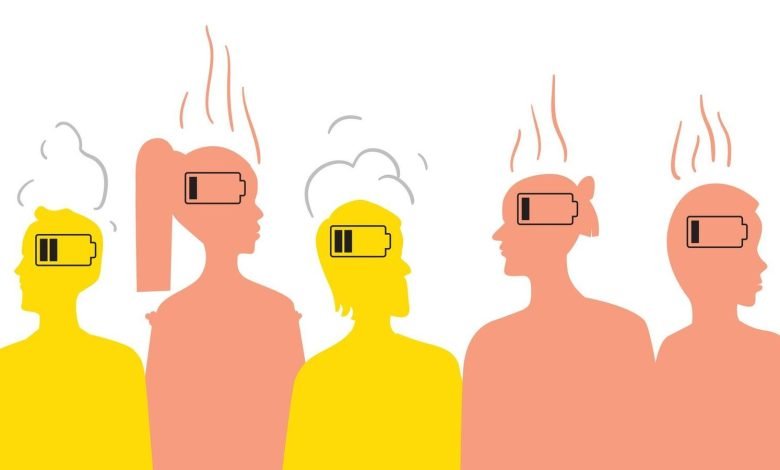
Berlin. Introvertiert, extrovertiert – oder etwas anderes? Rami Kaminski entdeckt den „Otrovertierten“ und erklärt, was ihn ausmacht.
Mehr als 40 Jahre arbeitete der amerikanische Psychiater Dr. Rami Kaminski mit Patienten aus Politik, Kunst und Wissenschaft. Immer wieder fiel ihm etwas auf: Manche seiner Klienten passten in keine der klassischen Kategorien der Persönlichkeitspsychologie. Sie waren weder klar introvertiert noch eindeutig extrovertiert.
Auch an sich selbst machte Kaminski diese Erfahrung: Wo andere Euphorie verspürten, blieb bei ihm Leere. „Schon damals merkte ich, dass ich irgendwie anders war“, schreibt er in der Fachzeitschrift „New Scientist“.
Um sicherzugehen, dass er nicht bloß seine eigenen Eigenheiten zur Theorie erhob, arbeitete er mit einem Biostatistiker zusammen. Gemeinsam entwickelten sie Tests und einen Online-Fragebogen, die „Otherness Scale“, um Muster sichtbar zu machen. 2023 gründete Kaminski schließlich das Otherness Institute. Dort widmet er sich einem Persönlichkeitstyp, den er „Otroverts“ nennt – abgeleitet vom spanischen otro, „der Andere“.
Anzeichen für Otroverts: Fragen, die den „anderen“ Persönlichkeitstyp entlarven
Auf der Webseite des Otherness Institute können Interessierte einen Fragebogen ausfüllen, die sogenannte Otherness Scale. Sie besteht aus einfachen Sätzen, denen man zustimmen oder widersprechen soll, darunter:
- „Ich habe nur sehr wenige Menschen in meinem Leben, denen ich wirklich nahe stehe.“
- „Wenn ich traurig bin, brauche ich Menschen, die mich aufmuntern.“
- „Ich betrachte Nachdenken als eine Aktivität.“
- „Ich bin immer der Erste, der von neuen angesagten Orten erfährt.“
- „Ich möchte verstanden werden.“
Wer sich in diesen Aussagen wiederfindet, erklärt Kaminski, habe gute Chancen, ein Otrovert zu sein. In einem Gastbeitrag für den „Guardian“ beschreibt er diese Menschen als „ewige Außenseiter“. Sie seien nicht erschöpft von Gesellschaft an sich, wohl aber von der Konformität, die Gemeinschaften fast zwangsläufig erzeugten. Das Problem sei nicht das Zusammensein mit anderen, sagte er, sondern „die Konfrontation mit dem Gruppendenken“.
Introvertiert, extrovertiert – und nun Otrovert? Ein neuer Persönlichkeitstyp im Vergleich
Die bekannten Kategorien von Introversion und Extraversion gehen zurück auf den Schweizer Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, der sie 1921 in seinem Werk „Psychologische Typen“ prägte. Seitdem haben sie nicht nur die psychologische Forschung, sondern auch unseren Alltag geprägt. Wer als introvertiert gilt, richtet seine Aufmerksamkeit nach innen, sucht Stille, Rückzug und fühlt sich von zu viel Geselligkeit ausgelaugt. Extrovertierte dagegen wenden ihre Energie nach außen, fühlen sich im Kontakt mit anderen lebendig und schöpfen ihre Kraft aus Begegnungen und Austausch.
Beiden Persönlichkeitstypen ist eines gemeinsam: Sie definieren sich über ihre Beziehung zu anderen Menschen – sei es durch Nähe oder durch Rückzug. Für Rami Kaminski reicht diese Dichotomie jedoch nicht aus. In seinen Beobachtungen, schreibt er, habe er eine dritte Kategorie identifiziert: Menschen, die sich weder durch Zugehörigkeit noch durch Distanz verorten. Er nennt Introvertierte und Extrovertierte deshalb „kommunale Typen“.
Otroverts, so Kaminski, seien dagegen ein eigenständiger Typus. „Sie müssen sich nicht aus der Gruppe zurückziehen, um neue Energie zu tanken“, erklärt er. „Es ist nicht die Gruppe, die sie erschöpft – es ist die Konfrontation mit dem Gruppendenken.“ Otroverts stünden am Rand der Gemeinschaft, manchmal in Opposition, aber nie in Abhängigkeit von ihr.
Lesen Sie auch: Überraschende Studien: Erkennt man Narzissten am Gesicht?
Alltag von Otroverts: Verhalten, das sie von Introvertierten und Extrovertierten unterscheidet
Wie sich Otroverts verhalten, wird besonders deutlich im Alltag. Auf einer Firmenfeier, so beschreibt es Kaminski, werde ein solcher Mensch nicht von Tisch zu Tisch wandern, um Small Talk zu betreiben. Stattdessen suche er lieber die Nähe einer einzelnen Person am Rand und führe dort ein intensives Gespräch. Mannschaftssportarten empfinde er nicht als Gemeinschaftserlebnis, sondern als Zwang. Und auch mit Ritualen wie Abschlussfeiern oder religiösen Festtagen fremdelten viele – für sie seien es weniger verbindende Momente als vielmehr irritierende Konventionen. Im „Guardian“ fasst Kaminski es zugespitzt zusammen: „Otroverts sind Solisten, die nicht im Orchester spielen können.“
Gleichzeitig, betont der Psychiater, dürfe man Otroverts nicht mit klassischen Introvertierten verwechseln. Sie seien keineswegs zwangsläufig still, scheu oder zurückhaltend. Viele träten selbstbewusst auf, äußerten ihre Meinung klar und wirkten sogar ausgesprochen gesellig – allerdings nur so lange, wie sie ihre innere Unabhängigkeit wahren könnten. „Das Problem ist nicht die Gesellschaft an sich“, erklärt Kaminski, „sondern die Gefahr, im Gruppendenken zu versinken.“
Gerade darin unterscheiden sie sich von Introvertierten. Ein stundenlanges Gespräch in einer ruhigen Kneipe mit einem engen Freund laugt diese aus, während ein Otrovert daraus Energie schöpft. Für ihn ist die Tiefe solcher Begegnungen nicht ermüdend, sondern belebend.
Prominente Otroverts: Von Frida Kahlo bis Albert Einstein
Dass es sich bei den Otroverts nicht um eine Randnotiz der Psychologie handelt, versucht Kaminski auch mit historischen Beispielen zu belegen. Immer wieder, so erklärt er, stoße man auf Persönlichkeiten, die in kein gängiges Raster von Intro- oder Extraversion passten.
Ein FUNKE Liebe
Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der
Werbevereinbarung
zu.
Da ist etwa Frida Kahlo, deren Malerei so radikal individuell war, dass sie sich konsequent allen Schulen und Bewegungen entzog. Oder Franz Kafka, der in seiner Literatur die Distanz zur Gemeinschaft und das Gefühl des Fremdseins wie kaum ein anderer verdichtete. Auch Albert Einstein sieht Kaminski in dieser Reihe: Dessen schöpferische Kraft sei aus einer fast kompromisslosen Unabhängigkeit des Denkens hervorgegangen.
Auch interessant: Psychologie enthüllt: Was unsere Art zu lieben über uns verrät
Die Schattenseiten von Otroverts: Außenseiter in einer Kultur der Anpassung
Doch Rami Kaminski verschweigt nicht, dass sein neuer Persönlichkeitstyp auch eine dunkle Seite hat. In einer Gesellschaft, die Anpassung, Teamgeist und das Dazugehören hochschätzt, stoßen Otroverts oft an Grenzen. Schon früh, so erinnert er, werde uns Menschen beigebracht, uns einzureihen: Wir sollen teilen, uns anstellen, leise sprechen, wenn die anderen es tun. Wer sich diesem stillen Konsens verweigert, gilt rasch als schwierig – oder, schlimmer noch, als „krank“.
Kaminski prägte dafür einen Begriff: das „Bluetooth-Phänomen“. Es beschreibt die unausgesprochene Erwartung, dass jeder sich wie selbstverständlich mit dem Kollektiv verbindet – so wie ein Gerät, das automatisch eine Verbindung herstellt. „Unsere Kultur geht davon aus, dass Zugehörigkeit der Normalzustand ist“, sagt er. Für viele Otroverts sei genau das der Punkt, an dem sie anecken.
Die Stärke des Nicht-Dazugehörens
Besonders problematisch werde es in der Jugend, erklärt Kaminski, wenn Identität und Selbstwertgefühl stark von Anerkennung in Gruppen abhängen. Wer dann lieber am Rand steht, sich abkoppelt und eigene Wege geht, läuft Gefahr, sozial ausgegrenzt oder missverstanden zu werden.
Das könnte Sie auch interessieren: Bis vor Kurzem wusste Jessica nichts von ihrer „Superkraft“
Trotz aller Schwierigkeiten betrachtet Rami Kaminski das Anderssein nicht als Defizit, sondern als wertvolle Ressource. Otroverts, sagt er, seien unabhängige Denker, die Probleme aus Blickwinkeln betrachten, die anderen oft verborgen blieben. Sie maßen ihren Erfolg nicht am Vergleich mit anderen, sondern an Maßstäben, die sie selbst bestimmten. Gerade weil sie nicht auf äußere Bestätigung angewiesen seien, entwickelten sie häufig eine besondere Kreativität und Originalität – und seien in ihrem Beruf oft erfüllter.