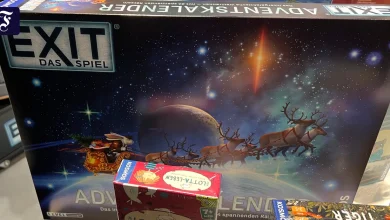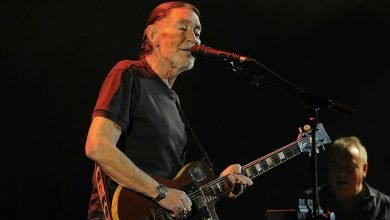Jimi Blue Ochsenknecht: Habe mich jeden Tag abgeschossen | ABC-Z

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht ist nach seiner Trennung von Yeliz Koç eigenen Angaben zufolge im Berliner Partyleben versunken. „Dann bin ich eh abgedriftet und so, habe in Berlin gewohnt, und da habe ich jeden Tag Party gemacht und mich abgeschossen“, sagte der 33-Jährige in der Sendung „Promi Big Brother“. Sich von Yeliz und ihrer gemeinsamen Tochter Snow zu trennen, sei der größte Fehler seines Lebens gewesen.
Die Schwangerschaft sei sehr kompliziert gewesen und er habe das Gefühl gehabt, die ganze Familie sei gegen ihn. „Und ich dachte mir, ich werde sowieso von allen gehasst und mache sowieso nichts richtig. Und dann bin ich halt einfach geflüchtet.“
Ochsenknecht erlebt erstmals Geburtstag seiner Tochter
Mittlerweile sieht sich Ochsenknecht aber wieder auf einem besseren Weg. „Snow ist jetzt vier geworden, und das ist der erste Geburtstag, den ich mitbekommen habe.“ Das bereue er. „Wenn man mental nicht auf der richtigen Spur ist und sich nur noch abschießt, ist es nicht einfach, wieder in die Spur zu kommen.“ Inzwischen funktioniere es aber wieder besser in der Familie. „Ich bin richtig gespannt, was die nächsten Jahre noch so passiert.“
Jimi Blue Ochsenknecht, Sprössling des Ochsenknecht-Clans um Vater Uwe und Mutter Natascha, hatte im Sommer mit einer unfreiwilligen Tour durch deutsche Gefängnisse Aufsehen erregt. Wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro war er am Hamburger Flughafen festgenommen und über mehrere Stationen nach Österreich ausgeliefert worden. Dort wurde das Verfahren gegen ihn gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro eingestellt.