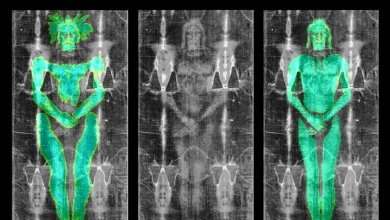Mütterrente und Kassenbeiträge: Wer bremst die Sozialausgaben? | ABC-Z

Mindestlohnerhöhung, Tariftreuegesetz und mehr Rente – das sind besonders eilige Projekte aus Sicht der SPD. Und mit ihnen hat die Partei das sozialpolitische Erscheinungsbild der schwarz-roten Koalition bisher stark geprägt. Umso mehr Aufmerksamkeit erregt nun ein Kontrapunkt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Er verspricht rasche und beherzte Änderungen am Sozialstaat mit dem Ziel, Ausgaben zu dämpfen und Regulierungen zu lockern. Die Wirtschaft ist entzückt, so teilt der Maschinenbauverband VDMA mit: „Die Ankündigung des Bundeskanzlers kommt zum richtigen Zeitpunkt und macht Mut. Gerade unsere mittelständischen Unternehmen und ihre Beschäftigten ächzen unter der Last immer weiter steigender Sozialabgaben.“
Mit Merz’ Ankündigungen erreicht die sozialpolitische Kursbestimmung eine entscheidende Phase. Denn bisher sah es oft so aus, als würden weniger populäre Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag in die Zukunft oder in Kommissionen verschoben. Dem steht nun diese Ansage des Kanzlers entgegen: Vor allem in den Sozialversicherungssystemen gebe es erheblichen Reformbedarf, der nicht nur eine Aufgabe für Kommissionen sei. „Wir werden das im zweiten Halbjahr 2025 sehr konkret mit Reformen auf den Weg bringen“, kündigte Merz an. Es gehe darum, dass „unser Sozialstaat bezahlbar bleibt und dass er nicht auch zusätzliche Kosten auslöst, die unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland immer mehr einschränken“, erklärte er am Dienstag vor dem Parlamentskreis Mittelstand der Union. Und schlug am Mittwoch in der Bundestagsdebatte ähnliche Töne an.
Doch wie wahrscheinlich sind die Entlastungen wirklich, die Merz verspricht? Als erstes größeres sozialpolitisches Projekt ist derzeit das Rentenpaket in Arbeit – das in den kommenden 15 Jahren zusätzliche Kosten in dreistelliger Milliardenhöhe auslöst: Die Koalition will den Demographie- oder Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel bis 2031 ausschalten und die sogenannte Mütterrente ein drittes Mal erhöhen. Den Gesetzentwurf dafür hat Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) Ende Juni auf den Weg gebracht. Da es sich nach schwarz-roter Nomenklatur um eine eilige Sofortmaßnahme handelt, soll ihn das Bundeskabinett gleich in der Sommerpause beschließen.
Ausgaben dürften weiter ansteigen
Wie Bas’ Entwurf ausweist, würden damit die Rentenausgaben bis zum Jahr 2040 um gut 200 Milliarden Euro erhöht. Davon entfallen etwa zwei Drittel auf die Mütterrente, die allerdings vor allem auf Druck der CSU zum Eilprojekt geworden ist. Das andere Drittel entfällt auf das Verstärken der jährlichen Rentenerhöhungen, das im politischen Sprachgebrauch auch als „Haltelinie für das Rentenniveau“ firmiert. Zwar sollen diese Mehrausgaben durch zusätzliche Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt gedeckt werden. Aber zu der eigentlich angestrebten Dämpfung der Sozialabgabenlast für Arbeitgeber und Arbeitnehmer führte es selbst dann nicht, wenn diese Steuerfinanzierung dauerhaft erfolgte, wie es Bas’ Entwurf unterstellt.
Der Wirtschaftswissenschaftler Martin Werding, Mitglied des Sachverständigenrats der Regierung, liefert diese nüchterne Bestandsaufnahme: „Bislang liegen in der Bundesregierung keinerlei Vorschläge auf dem Tisch, die den absehbaren Anstieg von Ausgaben und Beitragssätzen dämpfen könnten.“ Bisher würden nur Ideen ins Spiel gebracht, um die Einnahmen der Sozialkassen temporär zu erhöhen. „Da die demografische Alterung bis Mitte der 2030er-Jahre spürbar voranschreitet, sind solche Maßnahmen aber ungeeignet“, sagte Werding der F.A.Z.. „Sie tragen höchstens dazu bei, die nötigen Reformdiskussionen weiter zu vertagen.“
Höhere Kosten für Beschäftigte und Unternehmen
Hohe und weiter steigende Sozialbeiträge sind aber nicht nur unerfreulich für Beschäftigte, deren Nettoverdienst sie schmälern. Der Anstieg der Arbeitskosten für Unternehmen verringert auch deren Spielraum für Investitionen und schwächt sie im Wettbewerb. Merz’ Versprechen erfordert insofern eine Kehrtwende. Bisher erwartet die Regierung, mit oder ohne Erhöhungspaket, einen Anstieg des Rentenbeitrags von heute 18,6 Prozent des Bruttolohns auf 20 Prozent im Jahr 2028. Und zuvor werden Krankenkassen- und Pflegebeiträge absehbar weiter steigen. Schon jetzt überschreitet der Gesamtbeitragssatz der Sozialkassen die alte Obergrenze von 40 Prozent um mehr als zwei Punkte. Das Berliner Iges-Institut prognostiziert in seinem jüngsten Gutachten für die Krankenkasse DAK einen Anstieg auf gut 46 Prozent im Wahljahr 2029 (siehe Grafik).
Ob Gesetzliche Krankenversicherung oder Soziale Pflegeversicherung, in beiden Systemen wachsen die Ausgaben laufend stärker als die Einnahmen. Das liegt nicht nur an der Demographie, sondern auch an Leistungsausweitungen, etwa der Neudefinition und Erweiterung von Ansprüchen, an überproportional steigenden Pflegelöhnen und an höheren Zuschlägen für die Eigenanteile von Heimbewohnern aus den Pflegekassen.
Kassen kommen mit höheren Beiträgen nicht aus
In der Krankenversicherung ist im vergangenen Jahr ein Defizit von 6,2 Milliarden Euro entstanden. Die Pflege verzeichnete eine Lücke von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Daher sind die Beitragssätze im Januar kräftig gestiegen. Der offizielle durchschnittliche Zusatzbeitrag in der GKV erhöhte auf 2,5 Prozent; er fällt noch neben dem allgemeinen Beitragssatz Satz an. Der tatsächlich von den einzelnen Kassen erhobene Zusatzbeitrag ist im Mittel aber jetzt schon höher als vom Gesundheitsministerium vorgegeben. Einige Kassen haben ihn seit Januar weiter erhöht. Und der Regelbeitrag zur Pflege stieg im Januar um 0,2 Punkte auf 3,6 Prozent.
Doch damit kommen die Kassen trotzdem nicht aus. Um die Defizite auszugleichen und die Beiträge stabil zu halten, sieht die Ende Juni vom Bundeskabinett beschlossene Etatplanung Milliardendarlehen aus der Staatskasse für dieses und das kommende Jahr vor. Doch laut Iges ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Der Gesamtbeitrag zu den Krankenkassen – einschließlich tatsächlicher Zusatzbeiträge – steige 2026 von 17,5 auf 17,7 Prozent, in zehn Jahren erwartet das Institut 20 Prozent. Die DAK spricht von weitgehender „Wirkungslosigkeit“ der Stabilisierungsbemühungen auf Pump. In der Pflege sei 2026 ein Beitragsanstieg auf vier Prozent zu erwarten. Für das Ende der Legislatur werden 47 Prozent prognostiziert. Der Bundesrechnungshof erwartet dann ein Finanzloch von zwölf Milliarden Euro.
Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sagt offen, dass Beitragserhöhungen nicht abzuwenden sein werden, falls es nur bei den Darlehen bleibe. Der Bund müsse die versicherungsfremden Leistungen schultern. Warken setzt jetzt darauf, dass der Bundestag in den Etatberatungen noch einige Steuermilliarden für die Sozialkassen herausholt, um Beitragsanstiege abzuwenden. Möglicherweise hat sie nach dessen jüngsten Äußerungen dafür den Kanzler auf ihrer Seite.