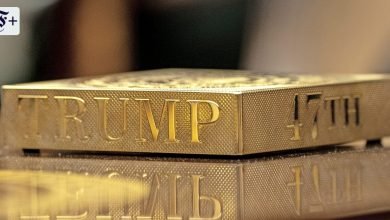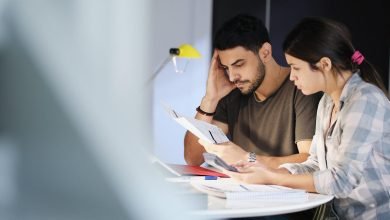Milica Vučkovićs Roman „Der tödliche Ausgang von Sportverletzungen“ | ABC-Z

Warum Menschen so lange in manipulativen oder gewalttätigen Beziehungen bleiben, bis sie daran zugrunde gehen, und warum es so oft die Antagonisten sind, die am anziehendsten scheinen, daran haben sich nicht nur leidende Liebende, sondern auch viele in der Kunst abgearbeitet. Schon Luis Buñuels früher Film „Er“ (1952) erkennt diesen Kreislauf: von Liebeserklärungen, Gewalt, Verschiebung des Erträglichen, Wut und Abstand, dann Reue und Vergebung. Und dann alles wieder von vorne.
Es war eine andere Zeit, im Korsett von Christen- und Bürgertum. Beides ließ sich damals, weil selbstgerecht, wunderbar vorführen. Das geht heute nicht mehr. Heute ist der Mensch dem Menschen Psychologe: Mit dem Etikett „toxisch“ geht die junge Generation beeindruckend inflationär um. Das kann sich auf vielerlei Objekte des Anstoßes beziehen: auf andere Menschen, Beziehungen, Verhaltensweisen oder Orte. Oft ist es ein Abstoßen von eigener Schuld oder die Folge von überzogenem Auf-sich-selbst-Hören, das im besten Fall „Self-Care“ ist – noch so ein Begriff –, im schlimmsten Fall Egomanie.
In solchen Gesellschaften des extremen Selbst, mit immer weniger Zwängen und immer mehr Eigenbewusstsein, lässt sich nichts Übergeordnetes mehr auseinanderbauen. Man kann nur noch zu sich selbst finden. Milica Vučkovićs Roman „Der tödliche Ausgang von Sportverletzungen“ ist im Original 2021 erschienen und war in ihrer serbischen Heimat ein großer Erfolg, vor allem bei jungen Leuten. Vielleicht gerade deswegen, weil sie sich überhaupt nicht an großen Parabeln, Pointen oder Abstraktionen versucht. Es ist eine psychologische Fallstudie.
Opfer seiner emotionalen Gewalt
Sie erzählt vom Niedergang einer mittelalten Frau namens Eva. Diese ist – von ihrer Mutter ungeliebt – in der Belgrader Peripherie aufgewachsen und kommt, mit Kind und Job gelangweilt, aus einer Beziehung mit dem faden Tomislav. Selbstbewusstsein hat sie keines, sie bezeichnet sich selbst als „Gebrauchtware“. Eva verliebt sich in den Schriftsteller Viktor und vergöttert dessen Männlichkeit, sein Zigarettenrauchen und großes Reden über Sozialkritik und Feminismus.
Viktor erweist sich immer mehr als einer der miesesten Antihelden, von denen man lange gelesen hat, als Negation alles Positiven: ein Heuchler, Schläger, Narzisst, ein Lügner und Betrüger, vor allem seiner selbst. Als sie ihm nach Deutschland folgt, wo er tags auf dem Bau, nachts an seinem großen schriftstellerischen Erfolg arbeitet, wird sie immer mehr zum Opfer seiner emotionalen Gewalt, später seiner körperlichen Misshandlungen.
Aus der zwar unsicheren, aber halbwegs im Leben stehenden Protagonistin ist ein Wrack geworden, verlebt, misshandelt und alkoholabhängig. Und: Es gelingt Eva nicht, sich aus den Schlingen ihres Peinigers zu befreien. Idealisten würden das als antifeministisch, defätistisch bezeichnen, Realisten wohl als psychologisch wahrheitsgetreu: Es sind nicht irgendwelche Menschen, die in solche Beziehungen hineinschlittern. Sie haben eine Vorprägung. Darum geht es der Autorin.
Unprätentiös, locker, persönlich
Vučković, Jahrgang 1989, ist eigentlich Malerin. Sie eine Dissertation über die Folgen sozialer Zugehörigkeit bei der Rezeption von Kunst geschrieben und ihre eigenen Werke in rund einem Dutzend eigener Ausstellungen gezeigt. Schon lange verfasst sie Lyrik, 2017 veröffentlichte sie in Serbien ihren ersten Roman, „Boldvin“, über die Titelheldin, die zur Alkoholikerin wird, um sich einer patriarchal geprägten Gesellschaft anzupassen.
Es sind nicht nur die Sujets, die sie zu dem machen, was sie ist – einer jungen Schriftstellerin, die für junge Leute schreibt –, sondern auch ihr Stil, ihr Schreibansatz. Zum Gespräch mit der F.A.Z. kommt sie etwas zu spät, bittet um Verzeihung, während sie von ihrem Roller steigt, auf dem Weg von ihrem Viertel am Stadtrand ins Zentrum habe es Stau gegeben.
Sie hat in ihr eigenes Café im Zentrum von Belgrad geladen, in den „Treuen Hund“. Schon als Studentin habe sie als Kellnerin gearbeitet, und wer das einmal gemacht habe, könne dem nur schwer wieder entkommen. Sie sei selbst in armen Verhältnissen aufgewachsen, als Kind serbischer Flüchtlinge. In der Hauptstadt Ausstellungsräume zu finden, sei schwierig, erzählt sie aus Erfahrung, deswegen habe sie vor der Pandemie regelmäßig jungen Künstlern hier dafür den Raum zur Verfügung gestellt.
Eine empathische Hobbypsychologin
Besondere literarische Vorbilder habe sie keine, aber sie sei ja auch nicht richtig vom Fach. Die Innenwelt „normaler“, echter Menschen sei viel spannender. Auch Evas Geschichte liegt die von Gewalt geprägte Beziehung einer Freundin zugrunde. Vučković ist unprätentiös, locker, persönlich, ohne überzogene Intellektuellenallüren. Und dennoch mit einem ungemein scharfen Blick auf ihre Umgebung: Ja, das geht.
Es ist daher stimmig, dass der Stoff für den Roman ostentativ einfach aufgezogen ist. Das ist engagierte Literatur im besten Sinne: Bildende Kunst und Literatur überschneiden sich bei ihr nicht, Letztere ist das Vehikel, auf Missstände aufmerksam zu machen. Es hält den Rücken frei fürs ästhetische Ausleben im anderen Fach.
Das Ergebnis ist ein unmittelbarer, antiheroischer Realismus. Der ist oft naiv, wenn Eva, die unzuverlässige Erzählerin, ihrem Viktor seine Tiraden abkauft, manchmal hässlich, explizit in seinen Gewaltdarstellungen, immer entwaffnend. Auch ohne das Pathos von Phantasmen und schriftstellerischen Extravaganzen strahlt aus der Erzählung all die Übelkeit und Bedrängnis, die man angesichts einer Person empfindet, die ihren Peiniger liebt. Vučković hat das Glück, eine etwas bessere und empathischere Hobbypsychologin zu sein, als wir es heute alle ohnehin sein müssen. Sonst hätte ihr Roman so nicht funktioniert, sonst wäre er zu einfach gewesen, der dritte oder vierte vorhersehbare Kreislauf von Gewalt, Reue und Vergebung nichts weiter als eine Wiederholung.
Letztlich erzählt der Roman auch eine Geschichte des Schweigens
Wenn man sich in Serbien heute in gleich welcher Angelegenheit trifft – hier, um über ihren Roman zu sprechen –, nehmen die seit Monaten andauernden Studentenproteste und ihr Auslöser, der desolate Zustand des serbischen Staates, die Perspektivlosigkeit und die Korruption, ohne die er nicht funktionieren würde, mindestens die Hälfte des Gesprächs ein.
Auch Vučković blickt mit Sorge auf ihre Heimat: Missstände gebe es überall, aber hier sei es besonders schlimm. Das größte Problem sei die Polarisierung des Landes: die gebildeten und städtischen Studenten als politisch naive Protestführer gegen oft kooptierte, regimetreue Massen, die darin ihren einzigen Weg aus der Armut sähen. Das ist im progressiven Zentrum vom Belgrad eine gewagte Aussage. Ihre Rolle als Künstlerin sieht sie im Ausgleich zwischen diesen Fronten. Man müsse einander hören, sich nicht unentwegt beleidigen. Das können beide Seiten gut.
Aus Südosteuropa gelangt vor allem das auf den deutschsprachigen Buchmarkt, was man am ehesten als literarische Landeskunde beschreiben könnte: Erzählungen von Krieg, Gewalt, Auswüchsen der Geschichte und Sachen, von denen man glaubt, es gebe sie nur jenseits der Alpen. Das gefällt, wegen der dennoch oft hohen ästhetischen Qualität dieser Literaturen, aber sicherlich auch wegen eines – oft, nicht immer unterbewussten – exotischen Reflexes.
Vučković weiß das. Sie erzählt von einer Lesung in Wien, auf der sie nach einer Autorin aus dem Nahen Osten mit ihrem Roman an die Reihe kam – und von den müden Mienen des Publikums, als es ihren Namen hörte, na super, noch ein Buch über Krieg. Autoren vom Balkan bedienten bewusst diese Opferrolle, weil das im Westen gut ankomme, behauptet sie, obwohl die Verwerfungen der Neunzigerjahre die jungen Leute nicht mehr interessierten. Es steht dahin, ob dieses Verdrängen nur von der Nation kommen kann, die selbst den größten Schaden angerichtet hat.
Erfrischend ist es, dass zur Abwechslung ein Text aus Serbien in deutscher Übersetzung erscheint, der eine europäische, zeitgenössische Geschichte erzählt, die genauso in Berlin, Paris oder New York hätte spielen können. Dennoch gibt es manches spezifisch Serbische in ihrem Roman. So wirft er auch einen soziologischen Blick auf die migrantischen, oft prekären Milieus in Deutschland: darauf, wie Menschen ihre Träume in der Heimat zurücklassen und als Fremde nie richtig ankommen, in einem Land mit unfreundlichen Vermietern und älteren Frauen, die im Park das Entenfüttern verbieten.
Die beschränkte Peripherie der serbischen Städte ist ein vielbespielter Topos, ebenso wie die Folklore um die „balkanoiden“ Männer, wie Vučković sie nennt, denen neben Bodybuilding, Tattoos und Alkohol nur noch das gelegentliche Ausrutschen der Hand zur perfekten Männlichkeit fehlt. Letztlich erzählt der Roman auch eine Geschichte des Schweigens, in Gesellschaften, die sich noch lebhafter an eine Zeit erinnern, in der es gewöhnlich war oder sich gar ziemte, von seinem Partner geschlagen zu werden. An der Scham darüber haben sich schon viele jugoslawische Schriftsteller abgearbeitet, am profiliertesten sicherlich der seinerzeit rege ins Deutsche übersetzte Montenegriner Miodrag Bulatović.
Milica Vučković: „Der tödliche Ausgang von Sportverletzungen“. Roman. Aus dem Serbischen von Rebekka Zeinzinger. Zsolnay Verlag, Wien 2025. 192 S., geb., 23,– €.