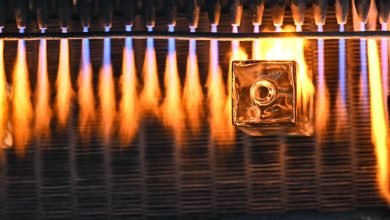Metas diskrete Helfer – Wirtschaft | ABC-Z

Nach ein paar Jahrzehnten Internet hat vermutlich jeder verstanden, dass man eher selten unbeobachtet unterwegs ist, wenn man durchs Netz surft. Meist bleibt es beim diffusen Unbehagen, aber nun ist eine Klagewelle angerollt, die einen Blick auf die detailscharfe Überwachung des Netzalltags erlaubt. Bundesweit sind mehrere Tausend Kläger gegen den Konzern Meta und dessen Datensammelei vor Gericht gezogen. Rund 2500 Urteile sind inzwischen in der ersten Instanz ergangen, also vor Amts- oder Landgerichten. Der größere Teil der Urteile ging zugunsten von Meta aus, aber mehrere Hundert Kläger haben inzwischen Schadenersatz erstritten – oft dreistellige Beträge, in einigen Fällen aber auch mehrere Tausend Euro.
Die Klagen wenden sich gegen digitale Helfer, die Meta in zahlreichen Webseiten installiert hat, mit dem Einverständnis der Betreiber und fast unsichtbar – sogenannte Business Tools. Die diskreten Gefährten des Digitalkonzerns lauern in Nachrichtenseiten, Online-Shops und Reiseportalen, aber auch in besonders datensensiblen Angeboten zum Thema Gesundheit oder Partnersuche.
Allein in Stuttgart sind fast 270 Klagen anhängig
Ihre Aktivitäten zielen vor allem auf die Nutzer von Facebook oder Instagram. Sind sie auf einer dieser Webseiten unterwegs, dann werden ihre Daten an Meta geliefert, wo sie mit den Nutzerinformationen verknüpft und zu einem fein gezeichneten digitalen Fingerabdruck verknüpft werden können. „Jeder Nutzer ist zu jeder Zeit individuell erkennbar, sobald er sich im Internet bewegt oder eine App benutzt“, heißt es in einem Urteil des Landgerichts Leipzig vom August. Und zwar auch dann, wenn er nicht bei Facebook oder Instagram eingeloggt sei. Pures Gold in den Händen eines Datenkonzerns, der sein Geld mit personalisierter Werbung verdient.
Die Massenklagen werden organisiert von Akteuren wie dem österreichischen Verbraucherschutzverein. Und von Anwälten wie Max Baumeister aus Berlin; er hat nach eigenen Angaben bereits rund 900 Prozesse gewonnen. An diesem Dienstag hat das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart die nächste Runde eröffnet, mit der Berufungsverhandlung zu dem Thema. Dort sind derzeit 268 solcher Prozesse anhängig. Der Streit wird nun eine Etage höher geführt, es wird grundsätzlicher.
Der OLG-Senatsvorsitzende Markus Geßler versuchte, die Erwartungen zu dämpfen: „Der Senat hat nicht die Aufgabe, mit allgemeinen Erwägungen das Geschäftsmodell von Meta zu durchleuchten.“ Zunächst einmal müsse geklärt werden, welche Webseiten der Kläger überhaupt besucht habe – und ob er dort einer Datenverarbeitung zugestimmt habe oder nicht.
Im Zentrum steht aus Geßlers Sicht aber die Frage, was mit den weitergeleiteten Informationen bei Meta eigentlich geschehe: „Genau diese Frage stellen wir uns auch: Was passiert mit den Daten?“ Rechtsanwalt Baumeister sieht hier Meta in der Pflicht, für Aufklärung zu sorgen. Das Unternehmen habe die Herrschaftsgewalt, bei ihr liege das alleinige Wissen darüber, welche Daten sie erhalte und verarbeite.
Mit personalisierter Werbung hat Meta 2021 laut dem Bundeskartellamt 115 Milliarden Dollar eingenommen
Nach der Darstellung von Meta werden die Daten nicht für personalisierte Werbung verwendet, wenn der Nutzer nicht zugestimmt hat – aber für „Sicherheits- und Integritätszwecke“. Was genau darunter zu verstehen ist, ist das große Rätsel dieses und vieler anderer Prozesse. Geßler wies darauf hin, dass die EU-Datenschutzgrundverordnung und der Europäische Gerichtshof hier enge Grenzen setzen. Eine Verarbeitung sei nur erlaubt, wenn sie zur Wahrung berechtigter Interessen wirklich „erforderlich“ sei. Dies habe Meta dem Gericht bisher aber nicht plausibel erklären können, sagte Geßler: „Ich sehe nicht, was genau die Zwecke der Verarbeitung sind. Uns würde auch interessieren, welche Daten das genau sind.“
Bleibt die Frage, ob sich daraus am Ende ein Schadenersatzanspruch ableiten lässt. Die Grundlage dafür hat im vergangenen Jahr der Bundesgerichtshof (BGH) gelegt. Danach können Betroffene für die Verletzung des Datenschutzes eine Art Schmerzensgeld verlangen. „Auch der bloße und kurzzeitige Verlust der Kontrolle über eigene personenbezogene Daten“ könne ein immaterieller Schaden sein. Der Anspruch, heißt dies, besteht auch ohne den Nachweis konkreter Einbußen – wie beim Schmerzensgeld eben.
Damals ging es um die eher symbolische Summe von 100 Euro. Aber in den Business-Tool-Fällen ist noch nicht so recht klar, ob es bei solchen niedrigen Beträgen bleibt. Das Landgericht Leipzig hatte nicht nur die Einbußen an Privatsphäre in Rechnung gestellt, sondern auch den Wert der Daten für den Konzern. Mit personalisierter Werbung hat Meta laut Bundeskartellamt 115 Milliarden Dollar im Jahr 2021 eingenommen. „Der finanzielle Wert eines einzigen Nutzerprofils, in dem sämtliche Daten über die Person gespeichert sind, ist für Teilnehmer datenverarbeitender Märkte enorm.“ Das Gericht erkannte auf 5000 Euro Schadenersatz.