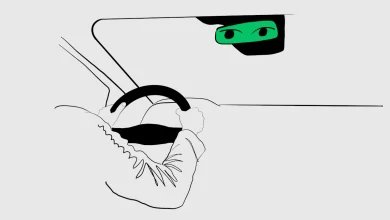Mark Leckeys „Enter Thru Medieval Wounds“ bei Julia Stoschek | ABC-Z

Mark Leckeys Kunst macht nüchtern. Und weil sie gerade zur Art Week gezeigt wird, in den Räumen der Sammlerin Julia Stoschek, muss man das als Kompliment verstehen. Warum seine Kunst nüchtern macht? Das mag wohl daran liegen, dass auf jeden Drogenrausch auch ein Kater folgt.
Aber von vorne: Eigentlich ist Mark Leckeys Kunst ein Horror-Trip. Die halluzinatorische Stimmung seiner Werkschau schleicht sich bereits in die eigene Wahrnehmung, da hat man die Ausstellungshalle im Erdgeschoss, dem ersten der drei bespielten Stockwerke, noch gar nicht ganz betreten. Grell oranges Neonlicht strahlt einem von den Laternen entgegen, die an den Wänden hängen – die Augen muss man zusammenkneifen und übersieht dabei fast, dass das Laternenlicht in unregelmäßigen Abständen kurz zu flackern beginnt und so zur Spekulation einlädt, ob es die Objekte sind, die hier spuken, oder doch der eigene Kopf.
Der Exzess und die Angst vor dem Absturz
Die Laternen stammen aus Leckeys Heimatort Birkenhead, einer herben Industriearbeiterstadt vor den Toren Liverpools, deren Brachen, Brücken und Betonbänke wiederkehrende Motive in Leckeys Kunst sind und damit so etwas wie biographische Gespenster – stille Zeugen des postindustriellen Niedergangs Nordenglands, die auch durch diese Retrospektive geistern.
„Das orange Licht war früher immer das Erste, was angefangen hat weird zu werden, wenn wir Mushrooms genommen haben“, erzählt Leckey und verweist auf zwei weitere Konstanten in seinem Werk: psychedelische Drogen und Raves. Die tiefen Augenringe, die beides im Antlitz des Künstlers zurückgelassen hat, verstecken sich jetzt, wo er vor einer seiner Arbeiten steht und darüber spricht, hinter den großen getönten Brillengläsern, die auf seiner Nase sitzen, und den locker ins Gesicht fallenden langen Haaren. Leckey, der in den späten 1990ern als eher randständiger Protagonist der Young British Artists neben Damien Hirst und Tracey Emin seinen Durchbruch feierte, ist ein Dandy. Allerdings einer – und das macht es für die gezeigte Kunst bedeutsam –, der die joviale Geste seines Dandytums auch deshalb mit ausstellt, weil sie für ihn als Sohn einer Arbeiterfamilie nie selbstverständlich war. Hinter dem Exzess lauert stets die Angst vor dem Absturz.
Diese Kippdynamik ist es, die aus der als Drogentrip eingeleiteten Show eine ernüchternde Erfahrung macht. Meisterhaft verwebt Leckey darin verschiedene mediale Ebenen – Online-Clips postpandemisch eskalierender Teenager, 3-D-gedruckte Modelle von Videospiellandschaften und wieder und wieder Alltagsgegenstände aus Birkenhead – zu einem immersiven Spektakel, das sich an den richtigen Stellen selbst unterbricht. So wird man zwar von Beginn an in diesen unablässigen Strudel hineingesogen, um dann aber von kurzen, im Timing aufeinander abgestimmten Pausen oder der blanken Banalität von Birkenheads ausgestellten Werbetafeln, U-Bahn-Schildern und Bushaltestellen wieder herauskatapultiert zu werden. Und in einer nüchternen Leere bei den eigenen Gedanken zu landen: Halluziniere ich, oder hat mir der Smiley-Sticker auf dem Subway-Plan gerade wirklich zugezwinkert?
Mittelalterliche Wunden
Passenderweise drängt sich beim Rundgang durch den ersten Ausstellungsraum zunächst ein Graffito auf, das sagt, „Carry Me Into The Wilderness“, bevor dann an der hintersten Wand ein LED-Schriftzug, das Wort „Void“, also Leere, auf- und abblendet und die ernüchternde Empfindung in ein physisches Objekt münden lässt. Auf den Rausch folgt der Kater. Bei Leckey kommen beide Erfahrungen gleichzeitig zusammen. In diesem präzisen Verunsicherungsspiel mit Wahrnehmungszuständen zeigt sich seine Kunst – in der Leere, die einen inmitten der Ekstase nüchtern und nachdenklich zurücklässt. Trotz der Überfülle an ausgestellten Arbeiten (was zurzeit ein Problem vieler Retrospektiven ist) schafft es Leckey, die Balance zwischen Verzauberung und Illusionsverlust zu halten.
Das merkt man auch seinen medienreflexiven Werken an. Zum Beispiel GreenScreenRefrigeratorAction von 2015, einem sprechenden Kühlschrank, der monolithisch vor einem Green-Screen thront und über sein Dasein sinniert. Überhaupt denken die magisch belebten Dinge in dieser Ausstellung oft und laut über sich selbst nach. Geht man weiter ins Kellergeschoss, findet man in einem stockdunklen Lagerraum, zwischen Transportkisten sitzend, eine überlebensgroße Skulptur in Denkerpose, das Abbild des Künstlers, übersät mit offenen Wunden, wie ein Leprakranker oder ein Fixer. Und wieder spuken die biographischen Gespenster: Aus Lautsprechern tönt ein innerer Monolog über den eigenen Verfall und den des britischen Sozialstaats, in dem Leckey noch aufgewachsen ist.

„Enter Thru Medieval Wounds“ heißt diese Arbeit und verleiht der Ausstellung ihren Titel. Referenzen ans Mittelalter finden sich in Leckeys Show an vielen Stellen. Seien es die verwunschenen Videospiellandschaften im Erdgeschoss, die den Bildhintergründen mittelalterlicher Malereien entliehen sind, oder Raver in schwarzen Kapuzen-Pullis, die sich in Videos, die im Kellergewölbe laufen, in tanzwütige Goblins verwandeln.
Auch der Keller selbst hat so einen Doppelcharakter. Mit den dort installierten Käfigen könnte er sowohl Folterkeller als auch ein Darkroom im Technoclub sein. Die Übergänge zwischen moderner Welt – digitaler Technologie, Clubkultur und Unterhaltungsmedien – und dunkler Mittelalter-Magie sind fließend. Trotzdem kippt man auch im Keller ständig in Nüchternheit zurück und versteht, dass die Lust am Abtauchen in die enthemmte Vorzeit äußerst gegenwärtig ist: Dark-Fantasy-Genres boomen, genauso wie politische Bewegungen, die vormoderne Weltbilder propagieren.
Die Kapitalisierung aller Lebensbereiche
Fragt man nach dem Grund dieser Regressionslust, landet man schnell beim Kulturkritiker Mark Fisher, der mit Mark Leckey nicht nur den Vornamen, sondern auch Generation und proletarische Herkunft teilt. Fisher, der sich 2017 nach langer Depression das Leben nahm, diagnostiziert in seinen Texten, was Leckey auch mit seiner Ausstellung zum Ausdruck bringt – dass die Kapitalisierung aller Lebensbereiche zum kulturellen Stillstand führt, hinein in eine aussichtslose Leere, in der mangelnder Sinn und Abstiegsängste durch permanente Berauschung und den Glauben an autoritäre Mächte kompensiert werden.
Für Fisher wie für Leckey gab es Anfang der 1990er noch eine Utopie, die dagegenhielt: der Rave. Dessen Poesie und Freiheit ist zwar längst wegkommerzialisiert, aber in Leckeys Arbeiten hat sich ihr nicht eingelöstes Versprechen konserviert. Schaut man sich oben, im Kino im ersten Stock, den Musikfilm „Fiorucci Made Me Hardcore“ an, eine wild montierte Genealogie der Rave-Kultur, mit der Leckey 1999 berühmt wurde, und tritt danach raus ins blendende Tageslicht, wo unten an der Kasse T-Shirts und Tonträger mit Motiven der Ausstellung als Merchandise verkauft werden, ereilt einen wieder diese Ernüchterung. Der Rave ist vorbei. Was bleibt, sind Rausch, Kater und Mark Leckeys Kunst.