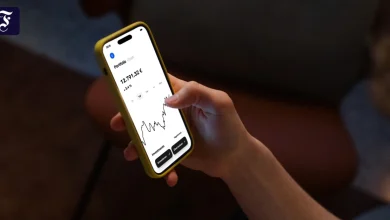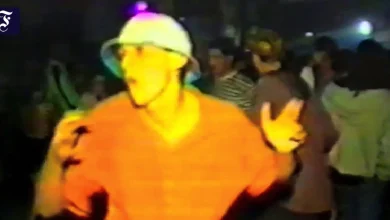Irina Scherbakowa und Swetlana Alexijewitsch in Berlin | ABC-Z

Als Gipfeltreffen in Sachen Literatur und Menschenrechte begrüßte die Journalistin Natascha Freundlich das von ihr geleitete Gespräch der russischen Memorial-Mitbegründerin und Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa mit der belarussischen Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch beim Internationalen Literaturfestival in Berlin, wo beide Exilantinnen heute leben. Der Dialog der 77 Jahre alten Stimmensammlerin Alexijewitsch, die den in ihrer Dokumentarprosa zu Grabe getragenen Roten Menschen schon in ihrem Roman „Secondhand-Zeit“ 2013 wiederauferstehen sah, und der 76 Jahre alten Germanistin und Historikerin Scherbakowa trug den Titel „Im Recht des Menschen“, stand aber im Zeichen des Rückzugs der Demokratie, den die Belarussin konstatierte, beziehungsweise des verlorenen Kampfes um Menschenrechte, von dem die Russin sprach, zuletzt auch in einem so proeuropäisch engagierten Land wie Georgien.
Wobei Alexijewitsch heute den altneuen roten Menschen im Kreml sitzen und gegen die Ukraine kämpfen sieht, während Scherbakowa den postmodernen Mix von Putins Ideologie hervorhebt, die neben rot-sowjetischen und braun-faschistoiden auch fortschrittlich-coole Facetten enthalte, wie etwa die florierende Moskauer Kulturszene beweise.
Ohne die Hilfe der USA
Die beiden kämpferischen Autorinnen sprachen von der Ratlosigkeit, die sie, angesichts der immer frecheren Vorstöße Russlands, nun auch mit Drohnen im Luftraum Polens und Rumäniens, bei Gesprächspartnern in Deutschland, im Baltikum oder in Finnland beobachteten. Da die Europäer ohne die Hilfe der USA auskommen müssten, wie Scherbakowa feststellte, hätten die Ukrainer nun auch gegen deren Hilflosigkeit zu kämpfen, so Alexijewitsch. Bei dem Militärmanöver mit dem programmatischen Namen Sapad (Westen), das Putin und Lukaschenko gegenwärtig abhielten, werde insbesondere der Einsatz taktischer Atomwaffen geübt, mahnte sie.
Angesichts des Schicksals der politischen Gefangenen, von denen der belarussische Präsident kürzlich 52 „freiließ“, im Austausch gegen die Aufhebung amerikanischer Sanktionen, sieht Alexijewitsch zudem das heroische postsowjetische Dissidentenethos in der Krise. Die Häftlinge erhielten nicht die Freiheit, denn die Belarussen unter ihnen durften nicht in ihrem Land bleiben, sondern wurden als „Verbrecher“ nach Litauen zwangsdeportiert. Der 69 Jahre alte frühere Präsidentschaftskandidat Nikolaj Statkewitsch verweigerte als Einziger den Grenzübertritt – sein Verbleib ist unbekannt, es gebe aber Meldungen, wonach er verhaftet wurde oder einen Herzinfarkt erlitt.
Nach jeder Freilassung neue Verhaftungen
Alexijewitsch bekannte, sie halte das Leben für das höchste Gut. Angesichts der Todesopfer würde sie jeden Häftling bitten, ein Gnadengesuch an Lukaschenko zu unterschreiben. Die imponierende Entscheidung der belarussischen Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa, die 2022 ihre Ausweisung verhinderte, indem sie ihren Pass zerriss, werde heute von einigen Anhängern bedauert, da ihre Gesundheit irreversibel zerrüttet sein soll. Der Präsident jongliere ja mit seinen Gefangenen, nach jeder Freilassung werde eine vielfache Zahl von Menschen neu verhaftet.
Beide Autorinnen, die familiär vom Zweiten Weltkrieg betroffen waren und den Großteil ihres Werkes dessen Aufarbeitung gewidmet haben, betonten, das Primat des Friedens sei in der spätsowjetischen Gesellschaft Konsens gewesen. Putin habe einen langen Marsch zurückgelegt, um, befeuert vom postsowjetischen Identitätsverlust vieler Russen, einen aggressiv nationalistischen Siegeskult aufzubauen, erklärte Scherbakowa. Wie auch Alexijewitsch sieht Scherbakowa die einzige Möglichkeit, pazifistische Ideen umzusetzen, paradoxerweise darin, dass Europa die Ukraine, aber auch sich selbst bewaffnet.
Scherbakowa hat mit einigen emigrierten Memorial-Mitarbeitern in Berlin die Bürgerbewegung Zukunft Memorial gegründet, auch als Antwort darauf, dass Putin sein Land in eine Vergangenheit zu führen verspricht, die es nie gab. Für die Möglichkeit eines Neuanfangs in Russland dokumentiere man Kriegsverbrechen der russischen Armee, sagte sie, sowie Menschenrechtsverletzungen in Russland. Man helfe politischen Gefangenen, aber auch deren oft selbst gefährdeten Anwälten, was freilich immer schwieriger werde. Als aufbauendes Schlusswort für die Ratlosen zitierte Scherbakowa einen Ausspruch der russischen Dichterin Anna Achmatowa, die der Verzweiflung eine manchmal hilfreiche Wirkung zusprach, während die Hoffnung nach ihrem Befund Menschen auch foltern und verrückt machen könne.