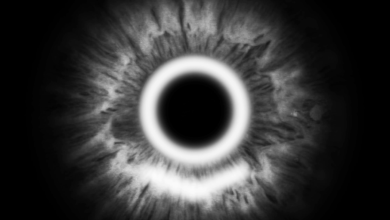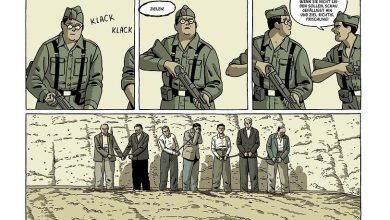Liederabend von Sabine Devieilhe in Salzburg | ABC-Z

In einem spöttischen Vers hat Heinrich Heine eine Grundstimmung des deutschen Lieds benannt: „Aus meinen großen Schmerzen / Mach’ ich die kleinen Lieder“. Das Französische verwendet zu „le lied“ ein Pendant: „mélodie“. Geprägt wurde der Begriff von Hector Berlioz. Von Gefühlen und Träumen wird in der „mélodie“ nicht mit trunkenboldigem Selbstmitleid gesungen, sondern, wie Pierre Bernac, der Großmeister des Fachs, sagte, mit hellwachem Verstand.
Welch ein plaisir, unter den sechs Salzburger Liederabenden dieses Sommers eine „Soirée française“ zu erleben – voller Anmut und artistischer Eleganz präsentiert von Sabine Devieilhe und dem Pianisten Mathieu Pordoy. Bekannt geworden ist die Sopranistin zunächst in Trapez-Partien: Mozarts Königin der Nacht oder Strauss’ Zerbinetta. Ihre silbrige Mädchenstimme hat mehr Fülle bekommen und dadurch reichere Farbvaleurs für das Ausleuchten des Textes.
Nach dem Entrée mit Gabriel Faurés „Chanson d’amour“ wandte sich Madame Devieilhe ans Publikum und erklärte die Mélodie – in der „j’aime“ siebenmal wiederholt wird – zum Motto des Abends. Im Programm: neben Fauré, Francis Poulenc, Maurice Ravel und Claude Debussy auch vom Zauber des Exotischen erfüllte Preziosen von Maurice Delage und Louis Beydts. Der Letztere ist in seinem Land als Komponist von Filmmusiken, Operetten und Musicals bekannt. Zentrales Thema seiner vier „Chansons pour les oiseaux“: die Macht der Liebe. Berückend die „comme en rêve“ (Vortragsanweisung) ausgeführten Figurationen und die schwebenden Pianissimo-C’s in „L’oiseau bleu“. Für höhere Heiterkeit sorgte Madame Devieilhe mit zwei aus den fünf „Banalités“ von Francis Poulenc: dem Dämmerlied eines Poeten, der im „Hôtel“ nur eine Zigarette anzünden will, dann mit den Knittelversen der Valse-Musette über die Verlockungen einer „Voyage à Paris“ sinniert, dargeboten mit dem kühlen Charme einer Chanson-Interprète.
In Ravels „Trois beaux oiseaux du Paradis“ – drei Vögel in den Nationalfarben Blau, Weiß und Rot überbringen einem Mädchen die Botschaft vom Tod ihres Geliebten – fand die Sängerin einen fahlen Ton, fast ohne Vibrato: Reduktion als Steigerung des Ausdrucks. Als Bravourstück dann Ravels „Vocalise-étude en forme de habanéra“ technisch makellos, aber eine Spur unterkühlt.
Unter dem Eindruck von Debussys „Pelléas et Melisande“ begann Maurice Delage mit einem privaten Musikstudium, auch bei Ravel. Nach ausgedehnten Reisen durch Indien unternahm er mit den „Quatre poèmes hindous“ den Versuch, melodische und rhythmische Formen der indischen Musik mit der westlichen Musik zu verbinden. Die Orte, an denen die Kompositionen entstanden, geben den vier Stücken die Namen: „Madras“, „Lahore“, „Bénares“ und „Jeypur“. Das Klavier musste dabei das im Original vorgesehene Kammerensemble und dessen irisierende Klänge ersetzen. Es blieb der exotische Zauber, gerade für den Camp-Geschmack, unwiderstehlich: etwa die hohen, fast heulenden Melismen am Ende von „Lahore“, die zur Intensivierung des Klangs ins Innere des Flügels hinein gesungen wurden.
Bei keinem Komponisten, schreibt Pierre Bernac in seiner Studie über den französischen Lied-Gesang, finde sich eine vergleichbar „mysteriöse Legierung“ von Musik und Poesie wie bei Claude Debussy. Zu den Gipfelwerken seines Schaffens gehören die „Ariettes oubliées“ auf Gedichte des Symbolisten Paul Verlaine. Der Titel der ersten, „C’est l’extase langoureuse“, sei übertragen auf eine Soirée, die man nicht vergessen kann. Standing Ovations für die anmutige und charmante Sabine Devieilhe, die sich mit vier Zugaben bedankte: darunter einem Chanson der allbekannten Barbara.