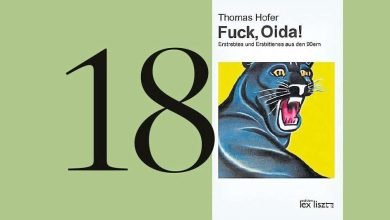Libanon und Israel: Leben unter Beschuss | ABC-Z

Beirut
In Libanon gibt es keine Schutzräume und keinen Luftalarm. Die Einschläge der israelischen Raketen kommen aus dem Nichts.
Dschassem, der Hausmeister, sah selten so erleichtert aus. Er beäugt misstrauisch den Himmel, wo das Sirren einer israelischen Drohne zu hören ist. Er druckst etwas herum, dann sagt er strahlend: „Ich dachte, du wärst auch schon weg. Es sind nur noch zwei Leute hier.“ Sogar der Tourismusminister sei nicht mehr da, sagt Dschassem. Aber solange überhaupt noch jemand in dem Haus wohne, beruhige ihn das.
Die Verunsicherung ist groß in Beirut, seit der Krieg zwischen Israel und der Hizbullah auch hier angekommen ist. Die Leute tasten sich in jeden Tag hinein, weil die Lage seit Wochen immer bedrohlicher wird und sie fürchten, dass es noch schlimmer kommt. Die israelische Luftwaffe fliegt heftige Luftangriffe auf die südlichen Vorstädte, in denen die Schiitenorganisation herrscht. Die Angriffe machen mehrstöckige Häuser dem Erdboden gleich, in denen oder unter denen die Schiitenorganisation Büros, Waffenlager oder Kommandozentralen verbirgt. Als das unterirdische Hizbullah-Hauptquartier bombardiert wurde und ein lang gezogenes, tiefes Donnern die Stadt aufschrecken ließ, bebten noch Kilometer von der Einschlagstelle entfernt die Scheiben.
Viele sind deshalb fortgegangen aus Beirut. Einige sind ins Bergland im Norden gefahren, wo ein leichter Nachtwind das Jaulen der Schakale durch die offenen Fenster weht statt das Grollen der Detonationen. An den Wochenenden zieht es auch zu normalen Zeiten viele Beiruter in ihre Wochenendhäuser. „Ich gehe in die Berge“, heißt es immer. Jetzt ist es die Ankündigung einer Flucht. Andere sind ausgeflogen, weil sie eines der raren Tickets ergattern können. Bis auf die libanesische Fluggesellschaft fliegt niemand mehr den Flughafen an, der nah am Kampfgebiet in Südbeirut liegt. Es gibt Fernsehbilder, die zeigen, wie eines der Flugzeuge landet, während Explosionen den Nachthimmel rot färben.
Die Ausgehstraßen sind wie ausgestorben
Dschassems Viertel ist ein sicheres Viertel. Es liegt im christlichen Osten von Beirut, der einer Insel gleicht. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, sollte es zum Ziel werden, weil die Hizbullah hier Führungspersonal oder Waffen versteckt hat. Denn hier mögen die Leute die Hizbullah nicht, und die christlichen Parteien und Führer wachen mit Argusaugen über ihre Viertel. Wer die Gegend nicht kennt, dem würde es tagsüber auf den ersten Blick kaum auffallen, dass viel weniger Menschen unterwegs sind oder in den Cafés sitzen. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, verweht das Leben auf den Straßen vollends. Dann sind nur noch sporadisch Scheinwerferpaare von Autos zu sehen. Auch die beliebten Ausgehstraßen sind so gut wie ausgestorben, die meisten Neonlichter seit mehr als einer Woche erloschen. Nur das Drohnen-Sirren bleibt. Ein paar Barbesitzer öffnen trotz der Anspannung ihre Bars, wo die Gäste ein paar Stunden lang die bedrückende Realität ausblenden können. Manchmal ist die Stimmung merkwürdig ausgelassen und das Zusammengehörigkeitsgefühl groß. Als seien alle Kameraden.

Ähnlich ist es auch in anderen Gegenden, zum Beispiel im Westen von Beirut, in den Gegenden entlang der Küstenstraße. Auf ihr sieht man immer wieder Jogger und Spaziergänger, während wenige Kilometer weiter die Erde unter den Einschlägen erbebt. Man darf ihr nur nicht zu weit nach Süden folgen, in die Schiitenviertel, die Heimat der Hizbullah-Klientel. Wer in die Dahiyeh fährt, die südlichen Vorstädte Beiruts, fährt in ein Kriegsgebiet. Und so werden Routen, die noch vor zwei Wochen völlig sicher waren, zu einer gefährlichen Angelegenheit. Der Krieg kriecht vom Hizbullah-Kernland im Süden Beiruts in andere Gegenden. Zum Beispiel in die reichen Ränder der Dahiyeh, die man noch vor wenigen Wochen besuchen konnte. Ein Freund riss beim letzten Besuch schon Witze darüber, dass man jetzt besser darauf achten sollte, keinen hohen Hizbullah-Kader im Haus oder in der Nachbarschaft zu haben. Vor einigen Tagen erschütterte ein Drohnenangriff eine Parallelstraße. Auch das Zentrum Beiruts ist inzwischen betroffen. Zwei Luftangriffe hat es dort schon gegeben, wahrscheinlich auch Drohnenangriffe.
Wo die Gentrifizierung keine Chance hat
Der jüngste war nicht sehr weit vom Stadtzentrum entfernt, wo auch das Parlament und der Sitz des Ministerpräsidenten liegen. Dort, wo die Rakete einschlug, herrscht die schiitische Amal-Bewegung von Parlamentspräsident Nabih Berri, die mit der Hizbullah im Bunde steht. Unter ihrem Befehl stehen die berüchtigten Schlägertrupps, die losgelassen werden, um politische Gegner einzuschüchtern und Demonstrationen aufzumischen. Die Gentrifizierung, die in der Umgebung um sich griff, hatte hier kaum eine Chance, weil das Viertel an einer neuralgischen Verkehrsader liegt und fest in der Hand der getreuen, ärmlichen Klientel bleiben soll. Die Armee traut sich manchmal nicht in die Gegend. Alteingesessene Christen aus den Nachbarvierteln wagen schon gar nicht, einen Fuß hineinzusetzen. Im Bürgerkrieg war es Feindesland. Jetzt, in diesen Kriegstagen, haben solche Grenzen eine ganz neue Brisanz.

Die inneren Spannungen steigen auch, weil mindestens eine Million Menschen aus dem Kampfgebiet – dem Süden Libanons, der Bekaa-Ebene im Osten und Dahiyeh – geflohen sind. Viele von ihnen berichten, dass sie schon einmal woanders Zuflucht gefunden hatten, bis der Krieg sie wieder einholte. Sie sind in jeder Hinsicht schutzlos. In Libanon gibt es keine Schutzräume, keinen Luftalarm. Die Einschläge kommen aus dem Nichts. Und die korrupte Regierung hat den Staat und seine Infrastruktur so heruntergewirtschaftet, dass die Bürde der Vertreibung einfach an die Bevölkerung weitergereicht wird – eine Bevölkerung, die schon seit fünf Jahren unter einer ruinösen Wirtschaftskrise leidet. Noch immer kampieren daher Geflohene auf Bürgersteigen, in Parks, schlafen in Autos. Manche gehen tagsüber kurz in ihre Häuser im Süden zurück und verbringen die Nacht am Strand, weil dann heftiger bombardiert wird. In westlichen Stadtvierteln melden die Nachbarn schon, dass Verzweifelte in leer stehende Wohnungen einbrechen. Auch die Sorge, dass die Not irgendwann in Gewalt umschlagen kann, macht sich in Beirut breit. Vor allem die christlichen Viertel im Osten sähen schiitischen Zuzug nicht gerne.
Wenn sich im Haus von Dschassem, dem Hausmeister, die schwere Gittertür am Eingang öffnet, schaut er aus seinem Hausmeisterzimmer hervor. Erblickt er ein bekanntes Gesicht, grüßt er erleichtert.
Christoph Ehrhardt, Beirut
Tel Aviv
Wenn es Raketenalarm gibt, packen die Israelis ihre Kinder ein und suchen Schutzräume auf. Seit dem 7. Oktober müssen sie das noch viel öfter tun als vorher.
Die Israelis sind ein krisenerprobtes Volk. Das Land steht seit seiner Gründung in einer Art Dauerkrieg und muss sich gegen Angriffe aller Art zur Wehr setzen, seien sie politisch oder militärisch. Auch die Besetzung der palästinensischen Gebiete seit bald sechs Jahrzehnten führt immer wieder zu Gewalt. All das kennen die Menschen. Viele haben selbst in der Armee gedient oder haben Verwandte, die als Wehrdienstleistende oder Reservisten eingesetzt werden. Das Militärische hat einen hohen Stellenwert in Politik und Gesellschaft. Umfragen ergeben immer wieder, dass die Israelis keiner Institution mehr vertrauen als der Armee.
Das vergangene Jahr hat diese zähe Gesellschaft einem nie da gewesenen Stresstest unterzogen. Viele Israelis sind traumatisiert durch den mörderischen Überfall der Hamas vom 7. Oktober. Alle Sicherheitsvorkehrungen versagten dramatisch, als Tausende bewaffnete Palästinenser aus dem Gazastreifen den Grenzzaun überwanden und mehr als tausend Israelis töteten. Auch das Vertrauen in die Armee hat dadurch gelitten.

Und das Trauma vergeht nicht. Der 7. Oktober, jener furchtbare Tag, sei immer noch nicht vorbei, hört man immer wieder Leute sagen. Die Wunden liegen offen da – man muss nur durch Tel Aviv gehen: Überall hängen Plakate, die an die verbliebenen 101 Geiseln im Gazastreifen erinnern. Praktisch täglich gibt es irgendwo eine Kundgebung, auf der die Freilassung der Verschleppten gefordert wird. Die Hoffnung, sie lebend wiederzusehen, wird mit jedem Tag geringer. Viele machen inzwischen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dafür verantwortlich, dass es immer noch keine neue Vereinbarung mit der Hamas gibt, die zu einer Waffenruhe und der Freilassung der lebenden Geiseln – möglicherweise nur noch ein paar Dutzend – führen würde.
Ruhe gebracht hat Netanjahus Strategie nicht
Aber Netanjahu hat kein Interesse an einer Waffenruhe. Der Ministerpräsident setzt vielmehr auf militärische Stärke und auf eine Strategie der Eskalation im Ringen mit Israels Feinden. Lange sah es so aus, als führe das zu keiner grundsätzlichen Veränderung der Lage. Aber in den vergangenen Wochen hat es dramatische Entwicklungen gegeben – allerdings nicht im Süden, an der Gazafront, sondern an der Grenze zu Libanon im Norden. Dort muss die Hizbullah, die am 8. Oktober begrenzt in den Krieg einstieg, um die Hamas zu entlasten, gerade heftige Schläge einstecken. Israelische Truppen sind inzwischen nach Südlibanon eingedrungen, zum ersten Mal seit dem „Sommerkrieg“ im Jahr 2006. Ruhe gebracht hat Netanjahus Strategie der „Deeskalation durch Eskalation“ den Israelis bislang aber nicht. Im Gegenteil ist die Lage vorerst unsicherer geworden. In Tel Aviv und im Zentrum Israels war das in den vergangenen Tagen und Wochen gut zu beobachten. Bis vor einem Jahr bedeutete in dieser Region Sirenenalarm, wenn es ihn überhaupt einmal gab, Beschuss aus dem Gazastreifen. Der war in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober intensiv, nahm dann aber stark ab und verebbte im neuen Jahr praktisch ganz.

Im September dieses Jahres mussten die Tel Aviver dafür erstmals wegen neuer Bedrohungen die Schutzräume aufsuchen: Sowohl die Huthi-Miliz im Jemen als auch die Hizbullah feuerten Raketen auf die Stadt ab. Und am Dienstag gab es ein weiteres „erstes Mal“: Raketenalarm aufgrund von Beschuss aus Iran. Gleich viermal hintereinander ertönten die Warnsirenen an jenem Abend in Tel Aviv, damit die Leute auch wirklich in den Schutzräumen blieben, mit denen in Israel alle neueren Wohnungen ausgestattet sind. In älteren Häusern gibt es meist einen gemeinsamen Schutzraum, in der Regel im Keller. Wer es nicht binnen neunzig Sekunden in einen solchen schafft, sucht irgendwo anders Zuflucht – möglichst nicht in der Nähe von Glasscheiben, denn die können zersplittern. Im schlimmsten Fall legt man sich flach an den Straßenrand und bedeckt Kopf und Ohren mit den Händen.
Israelis treffen sich zufällig – im Schutzraum
Schon im April hatte das Regime in Teheran Israel angegriffen. Damals kamen aber überwiegend Drohnen und Marschflugkörper zum Einsatz. Dank der Aufklärungsfähigkeiten Israels und seiner Verbündeten gab es eine Vorwarnzeit von mehreren Stunden. Am Dienstag feuerte Iran insgesamt zwar weniger Flugkörper ab – etwa 180 gegenüber mehr als 300 im April –, aber es handelte sich um ballistische Raketen. Die sind wesentlich schneller unterwegs – die Vorwarnzeit betrug nur zwölf Minuten.

Ebenso wie im April wurden die meisten Geschosse abgefangen. Seinerzeit hatten eine Koalition befreundeter arabischer Länder sowie die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich dabei geholfen. Dieses Mal erhielt Israel Unterstützung von den USA. Einige wenige Raketen schlugen ein, unter anderem offenbar auf Luftwaffenbasen. Es gab Sachschäden, im Westjordanland wurde ein Mann durch ein herabfallendes Raketenteil getötet.
All das wussten die Leute noch nicht, als sie sich in die Schutzräume flüchteten. Sie taten das wie immer, mit der Ruhe und Routine, die den Israelis zu eigen ist: Sind die Kinder da, haben wir alle Hunde dabei? Im Schutzraum herrscht dann eine oberflächlich normale Stimmung, mit der die Anspannung verdrängt wird. Man unterhält sich – die berühmten „90 Sekunden langen politischen Diskussionen, die Israelis führen, wenn sie sich zufällig im Schutzraum treffen“, wie ein Israeli es einmal nannte. Natürlich zückt man auch das Telefon und fragt Verwandte und Freunde, ob alles in Ordnung ist, oder sieht auf Nachrichtenseiten nach, ob es schon Meldungen zum Angriff gibt.
Währenddessen warten alle auf die erlösende Detonation – den dumpfen Knall, der anzeigt, dass die Rakete durch den Abwehrschirm in der Luft zerstört worden ist. Am Dienstag waren in Tel Aviv mehrere wuchtige Detonationen zu hören. Die Leute zogen beeindruckt die Augenbrauen hoch – eine massive Salve. Kurz darauf war klar, dass es sich um Beschuss aus Iran gehandelt hatte.
So schnell der Alltag unterbrochen wird, so rasch geht er in der Regel aber auch wieder weiter. An die zehn Minuten, die man den offiziellen Richtlinien zufolge nach einem Raketenalarm im Schutzraum verbringen soll, hält sich niemand. Warum auch? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man sich ohnehin bald am selben Ort wiedersehen wird. Daran, dass es anders werden könnte, glaubt ein Jahr nach dem 7. Oktober in Israel niemand.
Christian Meier, Tel Aviv