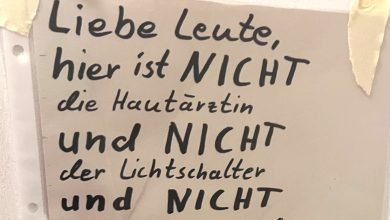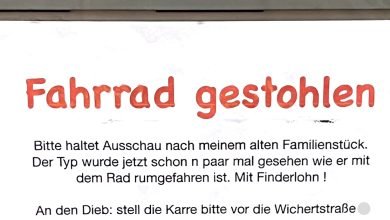Letzte Ausfahrt Belém? Das sind die Chancen | ABC-Z

Wenn die Mächtigen der Welt am Ende dieser Woche zusammenkommen, um über Klimaschutz zu beraten, werden sie in das Herz der Krise sehen können. Die brasilianische Metropole Belém, wo ab Donnerstag ein Gipfel von Staats- und Regierungschefs den Auftakt zur Weltklimakonferenz ab Montag markiert, liegt im Amazonas-Delta am Atlantik. Nicht weit von der Stadt beginnt der Regenwald, der zentral ist für die Stabilität des Klimas weltweit – und der gleichzeitig durch Rodung und ein verändertes Klima so bedroht ist, dass er einem unumkehrbaren Kipppunkt immer näherkommt.
Brasiliens Regierungschef Ignacio Lula da Silva hat Belém mit Bedacht ausgewählt für die diesjährige Weltklimakonferenz COP30. Er hofft, dass der Ort des Treffens die Zehntausenden erwarteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens inspirieren wird zu ehrgeizigen Ergebnissen. Denn die sind dringend nötig. Doch wie viel kann die diesjährige COP wirklich erreichen – in einer Situation, in der nicht nur der Klimaschutz global unter Druck steht, sondern schon das Konzept internationaler Zusammenarbeit an sich?
Zehn Jahre nach der Verabschiedung des Pariser Klimaschutzabkommens ist die Welt in Sachen Klimaschutz weit entfernt von dem, was sich die Staaten einmal vorgenommen hatten, und auch von dem, was nach Einschätzung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nötig ist. 2024 war das erste Jahr, in dem die weltweite Durchschnittstemperatur 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau lag. Anfang der 2030-Jahre wird das wohl auch im 20-Jahres-Mittel gelten. Und die weltweiten Emissionen steigen noch immer auf neue Rekordwerte, dabei müssten sie dringend sinken. Mit der derzeitigen Politik steuert der Planet laut der UN-Umweltagentur UNEP auf eine Erwärmung von 2,8 Grad zum Ende des Jahrhunderts zu.
Nur ein Drittel der Vertragsstaaten hat neue Klimaschutzpläne vorgelegt
Eigentlich hatten die Staaten sich 2015 vorgenommen, die Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad, bestenfalls 1,5 Grad, zu beschränken. Doch im September lief eine Frist aus, zu der die Vertragsstaaten neue, ehrgeizigere Klimaschutzpläne (Nationally Determined Contributions, NDCs) einreichen sollten, um die Lücke zwischen Realität und Anspruch zu schließen. Gerade mal ein Drittel der Vertragsstaaten lieferte tatsächlich. Erst am Mittwoch vor der Konferenz konnten sich die EU-Umweltminister nach langen Verhandlungen auf ein Klimaziel für 2040 festlegen: Die Treibhausgasemissionen sollen gegenüber 1990 um 90 Prozent gesenkt werden. Allerdings dürfen bis zu fünf Prozentpunkte durch Klimagutschriften aus Drittstaaten abgedeckt werden – faktisch reduziert die EU ihre Emissionen also nur um etwa 85 Prozent. Das ist weniger als die EU-Kommission vorgeschlagen hatte.
In vielen Staaten, vor allem in den reichen Industrieländern des globalen Nordens, hat der politische Schwung für Klimaschutz in den vergangenen Jahren deutlich nachgelassen – und das gerade in einem Moment, der für die Zukunft der Konferenzen kritisch ist. Denn zehn Jahre nach Paris ändert sich nach Einschätzung von Experten deren Charakter.
Über Jahrzehnte sei es vor allem darum gegangen, auf den Konferenzen Regeln auszuhandeln, nach denen der Klimaschutz funktionieren soll, sagt Petter Lydén, Experte für internationale Klimapolitik von der Umweltschutzorganisation GermanWatch. Diese Regeln seien jetzt da. „Jetzt geht es um Inhalte und Umsetzung: Wie viele Tonnen CO2 werden wirklich eingespart? Wie schnell? Wie viel Geld braucht man, wo kommt es her und wo geht es hin?“
Fragen, die vor einem zunehmend schwierigen geopolitischen Hintergrund gelöst werden müssen. In Deutschland und Europa saugt der Krieg gegen die Ukraine große Mengen Aufmerksamkeit und Geld auf. Global sorgen Handelsstreitigkeiten für wirtschaftliche Unsicherheit. Und bei Klimaverhandlungen in Bonn im Sommer machten viele sich entwickelnde Länder klar, dass sie einseitige Handelsregelungen wie den europäischen Grenzausgleich für CO2 als enorm unfair betrachten. Mit dem Ausgleich (Carbon Border Adjustment Mechanism, kurz CBAM) belegt die EU Produkte, die aus Ländern ohne CO2-Preis importiert werden, um so dafür zu sorgen, dass die heimische Industrie durch den Emissionshandel keinen Nachteil im globalen Wettbewerb hat.
Mafia-Methoden: Werden die USA die Konferenz torpedieren?
Und dann gibt es da noch die USA. Unter Donald Trump verlässt das Land, das nach China den zweithöchsten Ausstoß an Treibhausgasen hat, erneut das Pariser Abkommen. Doch in Belém sind die USA noch dabei – und werden vor Beginn argwöhnisch beobachtet. Hochrangige Regierungsvertreter werden zwar nicht teilnehmen, so viel hat Washington schon klargestellt. Doch Unruhe stiften und blockieren könnte die Delegation trotzdem. Als warnendes Beispiel haben viele noch die Verhandlungen im September über Klimaschutzmaßnahmen in der Schifffahrt vor Augen, die an den USA scheiterten. Teilnehmer sprachen von Mafia-Methoden. „Das könnte große Probleme verursachen“, sagt Lydén. „Die Konsensfähigkeit der Konferenz ist bedroht.“
Und die ist wichtig, denn Entscheidungen treffen kann die COP nur einstimmig. Das ist ein Grund, dass die Ergebnisse der Konferenzen, auch wenn sie hart erkämpft sind, weit weg sind von dem, was wirklich nötig wäre, um die Klimakrise wirksam zu bremsen.
Greenpeace fordert deshalb inzwischen, dass auch Mehrheitsbeschlüsse möglich sein sollen. „Wir müssen mittelfristig weg vom Einstimmigkeitsprinzip auf den COPs“, sagt Martin Kaiser, Chef von Greenpeace Deutschland, dieser Redaktion. „Wenn Trumps Art, Politik zu machen, sich durchsetzt, haben wir keine Chance.“ Die Länder, die keinen Klimaschutz wollen, werde man über Mehrheitsbeschlüsse zwar nicht binden können. „Aber für die, die Dringlichkeit kennen, hätte es eine stärkere Bindungskraft als jedes Jahr Beschlüsse, die den kleinsten gemeinsamen Nenner bilden.“ In zwei Wochen, sagt allerdings auch Kaiser, wird sich das aber nicht machen lassen.
Rund 90 Prozent der Menschen wollen mehr Klimaschutzpolitik
Viele von den dringlichsten Fragen – etwa die nach der Reduzierung der Treibhausgasemissionen und dem Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe – stehen in Belém ohnehin nicht auf der offiziellen Tagesordnung. Verhandelt wird unter anderem über mehr und konkret messbare Bemühungen zur Anpassung an den Klimawandel und über Klimafinanzierung. Gastgeberland Brasilien will außerdem mit einem neuen, milliardenschweren Fonds eine langfristige neue Geldquelle für den Schutz der Regenwälder schaffen. Aus dem Fonds mit dem Namen „Tropenwälder für immer“ sollen Länder mit tropischen Wäldern Prämien bekommen können für jeden Hektar Wald, der stehen bleibt.
Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
Hinter den Kulissen der Politik – meinungsstark, exklusiv, relevant.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der
Werbevereinbarung
zu.
Doch auch abseits der Tagesordnung muss es Fortschritte geben, fordern Beobachter. Und die kann es auch geben, sagt Lydén, wenn die Staaten, die wirklich Klimaschutz wollen, sich zusammenschließen und Druck ausüben. Potenzial sieht er unter anderem bei vielen südamerikanischen Ländern, bei Großbritannien und Australien, und auch bei der EU. Allianzen, sagt Lydén, werden „eine große Rolle spielen“.
Die Anforderungen an die Konferenz sind hoch. Denn auch wenn viele Regierungen lieber auf die Bremse treten würden, gibt es unter den Menschen immer noch einen den Wunsch, die schlimmsten Auswirkungen der Krise zu verhindern. Forschende aus Bonn, Frankfurt und Kopenhagen veröffentlichten im vergangenen Jahr eine Umfrage mit 130.000 Teilnehmenden aus 125 Ländern. Rund neun von zehn Befragten waren der Meinung, dass Regierungen und Menschen mehr tun müssten, um den Klimawandel zu bekämpfen.