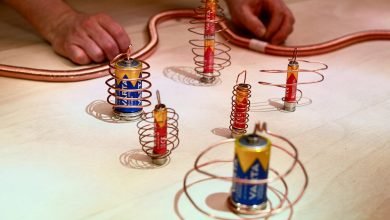Leicht hat man’s nicht mit der Demokratie – die SPD-Doku “Unten – Im Ortsverein” – Kultur | ABC-Z

Was wäre wohl aus Zohran Mamdani im Ortsverein der SPD Hamburg-Lohbrügge geworden? Angenommen, der Mann, gerade als selbsterklärter „demokratischer Sozialist“ zum Bürgermeister von New York gewählt, linke Hoffnungsfigur, bejubelt, wahrscheinlich mal wieder zu sehr bejubelt, dieser Mann wäre eines Tages aufgeschlagen bei einer Mitgliederversammlung, hätte sein rotes Parteibüchlein bekommen, danke, herzlich willkommen, Genosse, nächster Tagesordnungspunkt – wie wäre seine Geschichte weitergegangen?
:Ein „demokratischer Sozialist“ als Bürgermeister
Noch vor einem Jahr war Zohran Mamdani ein Nobody, jetzt soll der Senkrechtstarter die Welthauptstadt des Kapitalismus regieren. Sein Erfolg beschert den Demokraten eine Erkenntnis.
Solche Fantasien lassen sich leicht spinnen, wenn man die Dokumentation „Unten – Im Ortsverein“ guckt, die von dieser Woche an in den Kinos einiger deutscher Städte (und mutmaßlich auch in so manchem SPD-Ortsverein) gezeigt wird. Der Film von Jan-Christoph Schultchen, selbst Mitglied der Partei, schildert die Arbeit an der Basis der deutschen Sozialdemokratie, wie sie ist: unromantisch, mühsam, langsam. Tische werden zusammengeschoben und Zettel mit Tagesordnungspunkten verteilt. Jusos klagen verhalten, dass ihre Anträge es zwar bis zum Landesparteitag schaffen, dort aber so weit verwässert werden, dass sie nicht mehr wiederzuerkennen sind. Die Kreisdelegiertenkonferenz stimmt 70 zuvor in Arbeitsgruppen beschlossene Änderungsanträge zum Programm für die Bezirkswahl ab, begleitet von „Wir müssen die Menschen in den Mittelpunkt stellen“-Reden, zwischendurch gibt es Brezeln und Kaffee aus Pappbechern. „Und dann haben wir die Präambel auch schon durch.“ Wieder was demokratisch wegmalocht. Applaus.
Ist Hamburg nicht das New York Deutschlands?
In einem Tab läuft nun gerade der Stream dieses Films, im anderen ist Zohran Mamdanis Instagram-Kanal offen. Es stehen sich also gegenüber: die geradezu lustvolle Visionsfeindlichkeit der deutschen Demokratie, ihr endloses Kleinklein – und eine politische Utopie in Retro-Optik, mit orangefarben geschwungenem „Zohran“-Schriftzug im Stil der Siebzigerjahre und einem Krisselfilter auf den Filmaufnahmen. Schwer zu vergleichen, schon klar. Aber die liberale Demokratie, das sollte sich herumgesprochen haben, ist schließlich in Hamburg ebenso unter Druck wie in New York.

:Wieso macht das so viel Spaß?
Katzen streicheln, sechs New Yorker Clubs in einer Nacht besuchen, ein Video auf Arabisch drehen: Der Bürgermeister-Wahlkampf von Zohran Mamdani war ein einziger Feelgood-Clip. Eine Social-Media-Analyse.
Wohl keine Partei steht so sehr wie die SPD für den Glauben an ihre Verfahren und Institutionen, mehr noch als die Wirtschaftswunderparteien CDU und CSU. In die SPD tief reinzugucken, bis ganz nach unten, hinein ins Getriebe, ist deshalb nicht die schlechteste Idee für ein Filmprojekt. Man sitzt also da und beobachtet Menschen, die selbst dasitzen und auf Bildschirme starren und das Land nicht mehr verstehen. Irgendwann wird das Ergebnis der Europawahl 2024 verkündet, da trinken die Genossen still ihren Weißwein aus. Kevin Kühnert, damals Generalsekretär, spricht im Fernsehen über das Ergebnis, „das wir gemeinsam aufzuarbeiten haben“. Man sei als Partei jetzt wieder „ganz unten“, sagt der Ortsvorsitzende. Dann kriegen die alten Herrschaften ihre Nadeln für jahrzehntelange Mitgliedschaft, einer kannte Willy Brandt noch als Bürgermeister von Berlin.
Der Film ist ein bisschen wie die SPD selbst: steigt groß ein mit der „Internationalen“ und verwaltet dann seine eigene Idee. Wirbt für Parteiarbeit, aber beschönigt nicht. Ist sehr genau. Und manchmal braucht man beim Zuschauen einen Pappbecher Kaffee, um konzentriert zu bleiben.
Aber doch, ja, es lohnt sich. Man lernt etwas über diesen Betrieb. Zum Beispiel die Szene einer Weihnachtsfeier im Ortsverein Bergedorf West, einer Plattenbaugegend, gebaut Ende der Sechzigerjahre, also ungefähr zu der Zeit, auf die Mamdanis Schriftzug und Filmästhetik anspielen. Heute, sagt ein Juso-Mitglied, seien in der SPD vor allem Leute aktiv, die in den Sechzigern bis Achtzigern von der Partei profitiert hätten, „Aufsteiger:innen“, inzwischen arriviert. „Die haben die Zeit und die Ressourcen, sich einzusetzen in ihrer Partei.“ Und so singen dann einige wenige junge Menschen mit fast durchweg brauner oder schwarzer Haut bei der Weihnachtsfeier was von Christus dem Heiland, während sich die Alten aus Thermoskannen nachschenken. Die Jusos dürfen ruhig „Alerta, Antifascista“ bei der Demo rufen, das geht, weil das System ohnehin auf das Filtern und Verdünnen in den innerparteilichen Prozessen eingerichtet ist. Weil die Jungen zahlenmäßig sowieso keine Chancen gegen die Älteren haben.
Deutsche Parteien machen die Kleinen groß, zum Preis dafür aber auch die Großen klein
Das sei eben „die Realität des deutschen politischen Systems“, sagt ein junger Mann, „dass Dinge Zeit brauchen“. Eine Partei sei „kein Wohlfühlort“. Das hat seinen Sinn: Wer hier aufschlägt, breitet nicht die Arme aus, lächelt ein großes Lächeln und ist, wie Mamdani, wenige Jahre später Bürgermeister einer Großstadt. Deutsche Parteien, und ganz besonders die struktur- und prozessgläubige SPD, machen die Kleinen groß, zum Preis dafür müssen sie die Großen kleinkriegen. Auch der Bundestagsabgeordnete, auch die sozialdemokratische Wirtschaftssenatorin singen in Bergedorf West Weihnachtslieder und hören sich in den immer selben Runden von ihren Genossinnen und Genossen an, dass die Busse nicht fahren.
Bei der Weihnachtsfeier kriegt dann noch Abdullah, um die zwanzig Jahre alt, sein Parteibuch. Wahrscheinlich sieht sie ungefähr so aus, die Zukunft der Partei: ein bisschen so wie Zohran Mamdani. Wie würde es dem wohl in der SPD ergehen?
Unten – Im Ortsverein, Deutschland 2025 – Regie, Kamera und Schnitt: Jan-Christoph Schultchen. Musik: Bassel Hallak. Tonmischung: Holger Claßen. Mit: Ralf Stegner, Metin Hakverdi, Melanie Leonhard, Paul Veit. Barnsteiner, 80 Minuten. Kinostart: 6. November 2025