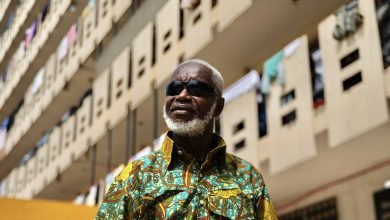Kunstpreis für inhaftierte Hanna Schwefel.: Die Kunst verehren, nicht das politische Handeln | ABC-Z

Kann man Kunst und Künstlerin trennen? Wird eine Person verurteilt, kann man es dann auch mit ihrer Kunst tun? Das widerfuhr neulich der Künstlerin und Antifaschistin Hanna Schiller. Sie war im März für den Bundespreis für Studierende nominiert worden. Einer der wichtigsten Auszeichnungen für junge Künstler:innen in Deutschland, finanziert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Doch dann verschwand ihr Name wieder von der Shortlist, die gestern eröffnete Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn mit allen Nominierten zeigt Hanna Schillers fragile, verstörende Objekte nicht.
Warum? Hanna Schiller, Jahrgang 1994, wurde nach vielen Monaten in Untersuchungshaft kürzlich vom Oberlandesgericht München zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sie soll an einem gewalttätigen Angriff auf Neonazis in Budapest beteiligt gewesen sein, die sich dort zum alljährlichen „Tag der Ehre“ versammelten. Sieben Linken wird im Budapest-Komplex gerade der Prozess gemacht. Schon vor ihrer Verurteilung im September hatten rechte Medien ordentlich gegen die Nominierung von Hanna Schiller gehetzt, „Linksextremistin kriegt 45.000 Euro und Kunstpreis“ titelte die Bild. Blogger sollen gar Druck auf Jurymitglieder des Bundespreises ausgeübt haben, sodass Zweifel aufkommen, wie unabhängig das Preiskomitee noch agieren konnte, als es Hanna Schillers Nominierung im Zuge ihres Gerichtsprozesses wieder aussetzte.
Nun aber bezieht die Münchener Kurt Eisner Kulturstiftung Stellung in der Frage, ob man nun mit der Kunst auch das politische Handeln der Künstlerin ehre. Gerade verkündete sie, dass sie Hanna Schiller mit dem diesjährigen Kurt Eisner Preis auszeichenen möchte, „für ihre herausragende künstlerische Praxis“. Mit keinem Wort geht die Stiftung in ihrer Pressemitteilung auf Hanna Schillers antifaschistische Aktvitäten ein, auch nicht auf ihr kürzliches Hafturteil am Münchener Oberlandesgerichts, das Kritiker:innen als „politisch motiviert“ und als „Gesinnungsurteil“ deuten.
Nicht die Person, sondern die Kunst
Nicht auf die Person Hanna Schillers, sondern allein auf ihre Kunst will die Stiftung mit dieser Auszeichnung aufmerksam machen. Die mache „kontinuierlich drängende politische Themen wie etwa das Erstarken rechtsextremer Strömungen, die damit verbundene Krise der Menschenrechte in der aktuellen Migrationspolitik oder zum Beispiel strukturellen Sexismus, in hoher Reflexion einer Diskussion zugänglich“, heißt es in der Pressemitteilung.
Hanna Schillers Objekte sind fein und verstörend: Ein Fußabtreter aus Frauenhaar, eine filigrane Kette aus Gesetzestexten, deren einzelne Glieder im Mittelmeer ertrunkene Geflüchtete versinnbildlichen. Haar, Garn und Papier verbindet Schiller, die bis zu ihrer Haft noch an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg studierte, scheinbar selbstverständlich mit handwerklichen Techniken. Ihre Kunst ist eindrücklich und irritierend, sie ist ästhetisch und sie ist sehr politisch.
Vor Hanna Schiller hatte die Kurt Eisner Kulturstiftung seit 1988 eine ganze Reihe politischer Künstler:innen ausgezeichnet, Hans Haacke, Christian Boltanski, Olaf Metzel, zuletzt Silke Wagner und Friedemann Derschmidt. „Kunst kann nur gedeihen in vollkommener Freiheit … Der Künstler muss als Künstler Anarchist sein …“ zitiert die Stiftung ihren Namensgeber Kurt Eisner aus seiner Rede vor dem provisorischen Nationalrat am 3.1.1919.
Die Ankündigung, den Preis an Hanna Schiller zu verleihen, fällt nicht nur auf die Eröffnung der Ausstellung der Bundespreis-Nominierten in Bonn, deren Teilnehmer:innen übrigens vorab doch noch Hanna Schillers Arbeiten in einer Konterausstellung öffentlich zeigten. Im November 2025 jähren sich auch die revolutionäre Beendigung der Adels- und Militärdiktatur in Deutschland und die Gründung des Freistaats Bayern durch Kurt Eisner, den pazifistischen Revolutionär und ersten Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, zum 107. Mal. Es geht bei dem Ganzen natürlich um ein politisches Statement, aber auf der Ebene der Kunst.