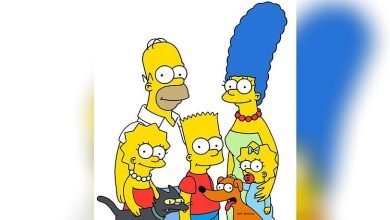Moderatorin Arabella Kiesbauer ist “selbst eine Drama-Queen” | ABC-Z

Sie begeisterte in den 90ern mit ihrer Talkshow “Arabella” ein Millionenpublikum, jetzt feiert Arabella Kiesbauer (56) ihr großes Comeback im deutschen Fernsehen. Ab dem 7. Mai übernimmt die Moderationslegende bei “Kampf der Realitystars” (mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei, eine Woche vorab bei RTL+) das Zepter von Cathy Hummels (37). In Thailand trifft sie auf Kandidaten wie die Schauspieler Stephen Dürr und Anouschka Renzi, Fußballstar Ailton und Drama-Garant Can Kaplan, die alle auf die Nachfolge von Vorjahressieger Calvin Kleinen hoffen.
Bei ihrer neuen Aufgabe kommt Arabella Kiesbauer ihre langjährige Erfahrung mit turbulenten Situationen zugute, wie die gebürtige Wienerin im Interview mit spot on news verrät – umso schöner für sie, dass sie dafür den alltäglichen Dramen mit ihren Teenager-Kindern zumindest vorübergehend entkommen konnte. Außerdem erklärt sie, warum sie selbst niemals in die “Sala” einziehen würde – und welcher Kandidat perfekt in eine Folge ihrer Kult-Talkshow “Arabella” gepasst hätte.
Bei “Kampf der Realitystars” ist “Sendezeit” die inoffizielle Währung. Wie sehr freuen Sie sich, dass Sie Ihre Sendezeit wieder kriegen?
Arabella Kiesbauer: Ich liebe das Format. Mich hat die Sendung gereizt – da habe ich gleich geschrien: Ich bin dabei! Und zwar mit großer Begeisterung. Und ich habe meine Sendezeit gut genutzt. Das ist natürlich auch für die Realitystars das A und O: Dass sie liefern, dass sie die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten. Dazu gehört natürlich, Sendezeit zu generieren.
Wie sehr haben Sie das Drama in Ihrem Leben vermisst?
Kiesbauer: Ich bin ja schon manchmal selbst eine Drama-Queen – also für das eine oder andere Drama bin ich auch selbst zuständig. (lacht) Dann habe ich zwei pubertierende Kinder zu Hause, also Drama haben wir momentan sehr viel. Aber ja, bei einer Sendung bin ich natürlich schon eine, die gerne nachfragt und nachbohrt. Und auch gerne Konflikte noch mal aufarbeitet.
Apropos Familie: Wie war es für Sie, für die Dreharbeiten so lange von Ihren Lieben getrennt zu sein?
Kiesbauer: Nachdem es bei uns wirklich aufgrund der Pubertät manchmal sehr turbulent ist, war es teilweise tatsächlich sehr angenehm. (lacht) Aber dreieinhalb Wochen ohne Family ist schon lang – da haben mir die Kids doch sehr gefehlt.
Auf Instagram ist zu sehen, dass Sie die Wochen in Thailand sehr genossen haben…
Kiesbauer: Der Punkt ist, ich durfte ja nichts von der Sendung posten. Deswegen sieht es so aus, als ob ich wirklich dreieinhalb Wochen nur Urlaub gemacht hätte. Der Schein trügt! (lacht) Die Dreharbeiten waren zwar wirklich wunderbar und die Leute herzallerliebst – aber es war auch Arbeit. Das sieht man dann erst im Fernsehen. Man muss das Leben aber genießen und die Feste feiern, wie sie fallen.
Haben Sie in den letzten Jahren “Kampf der Realitystars” selbst verfolgt?
Kiesbauer: Ich bin ein großer Reality-Fan und schaue querbeet viele unterschiedliche Formate aus verschiedenen Ländern. Ich schaue allgemein noch viel fern – ich bin ja die Generation, die sich noch vor die Glotze setzt. Aber was ich bei “Kampf der Realitystars” besonders mag, sind die Spiele. Die sind so kreativ, das hat für mich schon einen besonderen Reiz.
Sie treten die Nachfolge von Cathy Hummels an. Was werden Sie anders machen als Ihre Vorgängerin?
Kiesbauer: Ich bin ein anderer Typ. Ich habe auf jeden Fall den Talk in der “Stunde der Wahrheit” ausgebaut. Das ist meine Kernkompetenz. Wenn ich was wissen will, bin ich neugierig und frage da auch wirklich ganz gezielt nach.
Cathy Hummels stand für ihre Moderationskünste teilweise in der Kritik. Haben Sie Angst, dass Ihnen Ähnliches passiert?
Kiesbauer: Ich bin da sehr relaxed. Ich mache seit 40 Jahren nichts anderes, das ist mein Beruf – da weiß ich schon, dass ich das kann.
Sie haben in Ihrer Talkshow schon so einiges erlebt – kann Sie da im Reality-Kosmos überhaupt noch etwas aus der Fassung bringen?
Kiesbauer: Der Talk war natürlich eine unglaublich gute Schule, weil ich immer auf das reagieren musste, was gerade passiert ist. Dann habe ich sehr viele Live-Sendungen gemacht – da muss man mit unvorhergesehenen Situationen zurechtkommen. Aber auch bei diesen Dreharbeiten – das ist das Schöne, deswegen wird es ja auch nicht langweilig – sind wieder Sachen passiert, bei denen ich mir gedacht habe: Ja hoppla, was ist denn da jetzt los? Aber das wird man dann sehen… Wenn mir zum Beispiel jemand die Antwort verweigert, das mag ich gar nicht.
In einem Interview sagten Sie, früher sei es in der Talkshow auch manchmal zu weit gegangen. Wie spannen Sie den Bogen zwischen Unterhaltung und Empathie?
Kiesbauer: Gewisse Regeln im Zuge einer gepflegten, aber doch intensiven Gesprächskultur müssen einfach befolgt werden. Um das durchzusetzen, bin ich da. Ich habe kein Problem, auch mal auf den Tresen zu hauen und das klarzumachen.
Wer aus der “Kampf der Realitystars”-Riege hätte es damals zu “Arabella” geschafft? Und mit welcher Geschichte?
Kiesbauer: Definitiv Can: “Meine Ex hat mich betrogen.” Oder: “Ich treffe heute auf den Flirt-Buddy von meiner Ex”. Alles rund um die dramatische Beziehung mit seiner Ex-Freundin – das würde gut passen.
Gab es jemanden, auf den Sie sich besonders gefreut haben?
Kiesbauer: Ich habe mich auf das Wiedersehen mit Martin Semmelrogge gefreut, weil ich ihn seit 25 Jahren kenne. Aber auch bei den Jungen bin ich neugierig. Manche kannte ich von der Vorbereitung, aber noch nicht persönlich. Es ist spannend zu sehen: Wie sind die face-to-face, wie stellen sie sich in der Sala an und wie wird der Gesprächsaustausch?
Mit Tara Tabitha ist auch eine Landsfrau von Ihnen dabei. Gibt es da eine stille österreichische Allianz?
Kiesbauer: Ich bin ganz neutral. Das gehört sich meiner Meinung nach auch so als Moderatorin. Mich muss jeder oder jede in jeder Sendung ganz aufs Neue beeindrucken – oder eben nicht.
Haben Sie eine Strategie, wie Sie mit polarisierenden Persönlichkeiten umgehen?
Kiesbauer: Das muss man einfach direkt dezidiert ansprechen und sagen, so geht es einfach nicht. Gewisse Ausdrücke oder Entgleisungen möchte ich nicht hören. Gesprächskultur kann auch leidenschaftlich sein – ich bin ja selbst keine Langweilerin. Aber man muss sich nicht aufs Übelste beschimpfen, das ist nicht produktiv. Wir wollen miteinander sprechen und nicht dafür sorgen, dass dort ein beleidigter Mensch steht und weint und nicht mehr weitermachen kann.
Wenn Sie selbst in die Sala einziehen würden, was wäre Ihre größte Herausforderung?
Kiesbauer: Ich bin denkbar ungeeignet. Auf einem so engen Raum mit Leuten, die jetzt nicht zu meinem persönlichen Freundeskreis gehören, das wäre für mich auf jeden Fall die größte Herausforderung. Die Spiele fände ich aber toll. Da wäre ich sofort dabei. Aber ich würde auch alles geben. Bei mir muss man dann aufpassen, dass ich mich nicht verletze vor lauter Engagement. (lacht)
Was erwartet die Fans in dieser “Kampf der Realitystars”-Staffel?
Kiesbauer: Der absolute Wahnsinn. Es ist ja logisch: Wenn so viele bunt zusammengewürfelte Leute auf so engem Raum in einer WG zwangsverbrüdert und -verschwestert werden, das bietet natürlich sehr viel Konfliktpotenzial. Aber natürlich ergeben sich auch emotionale Verbandlungen. Es war alles mit dabei. Es ist sicherlich eine Ausnahmesituation für die Realitystars – und damit auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de