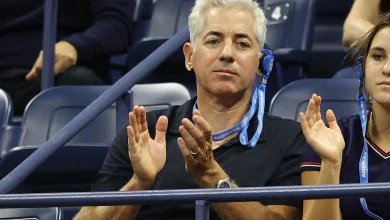Kritik an prekären Arbeitsbedindungen der Fahrer | ABC-Z

Als die Organisation Fairwork 2022 zuletzt ihren Bericht über die Arbeitsbedingungen in der deutschen Plattformökonomie vorlegte, war die Branche eine andere. Gorillas war da noch ein schnell wachsender, aufstrebender Zehn-Minuten-Lieferdienst; der türkische Wettbewerber Getir griff gerade auch auf dem deutschen Markt an. Beide Anbieter sind heute in Deutschland nicht mehr aktiv. Kaum verändert haben sich der Analyse zufolge aber die Arbeitsbedingungen von Essenskurieren, Pflegekräften oder Mietwagenfahrern, deren Dienste die Plattformen vermitteln. Es sei eher eine Verschlechterung zu beobachten, schreiben die Autoren des am Montag vorgestellten Fairwork-Berichts zu den Arbeitsstandards in der deutschen Plattformökonomie.
Hinter Fairwork stehen das Oxford Internet Institute der University of Oxford und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Die Forscher haben öffentlich zugängliche Daten analysiert, Interviews mit Plattformarbeitern und – wo möglich – mit Managern geführt. Ihre Bewertung haben sie in fünf Kategorien unterteilt: Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Verträge, Managementprozesse und Mitbestimmung. Für jede Kategorie vergeben die Forscher je nach erfüllten Kriterien null bis zwei Punkte. Maximal konnten die Unternehmen also zehn Punkte erhalten.
Mit vier Punkten an der Spitze ist Lieferando gelandet, gefolgt vom Supermarktlieferdienst Flink mit drei Punkten und der Haushaltshilfen-Vermittlungsplattform Helpling mit einem Punkt. Die Fahrtenvermittler Bolt und Uber sowie die Essenslieferdienste Uber Eats und Wolt gingen komplett leer aus. Nur Flink habe laut Fairwork beispielsweise nachweisen können, dass seine Kuriere während der gesamten Arbeitszeit nach Abzug der arbeitsbezogenen Kosten den gesetzlichen Mindestlohn erhalten.
Was ändert die EU-Regulierung?
Kosten waren dabei unter anderem unbezahlte Wartezeiten, Reisekosten, Fahrzeugkosten, Spritkosten, mobile Daten, Autowäsche oder Versicherungskosten. „Unsere Fahrer verdienen durchschnittlich mehr als 14 Euro pro Stunde in regulärer Anstellung mit einem festen Stundenlohn sowie ergänzenden Boni“, teilt Lieferandos Logistikgesellschaft Takeaway Express der F.A.Z. mit – Fairwork bemängelt, dass die Arbeitszeiterfassung nicht die Zeit für den Rückweg der Fahrer zum Wohnort einberechne. Zudem lege keine der Plattformen transparent offen, wie genau ihr Algorithmus über die Auftragsvergabe entscheidet. Kuriere oder Fahrer fühlen sich oft vom Algorithmus übermäßig hart bestraft, wenn sie mal einen Auftrag ablehnen.
Die Arbeitsbedingungen der sogenannten Plattformarbeiter sind längst Thema in Brüssel. Das Europäische Parlament hat im vergangenen Jahr das „Gesetz zur Plattformarbeit“ beschlossen, dass Plattformarbeiter mit normalen Angestellten gleichzustellen sind. Dafür wird die Beweislast umgekehrt. Die Plattformen müssen belegen, dass sie ihre Arbeiter nicht so wie Festangestellte kontrollieren. Nur dann dürfen sie diese als selbständig einstufen. Innerhalb von zwei Jahren soll die Bundesregierung die Richtlinie in nationales Recht umsetzen.
Unterschiedliche Geschäftsmodelle
Die Anbieter weisen den Vorwurf der Scheinselbständigkeit von sich. Lieferando und Flink stellen alle Fahrer direkt an. Der Wettbewerber Uber Eats arbeitet stattdessen in Deutschland mit Logistikdienstleistern zusammen, Wolt stellt ebenfalls nur einen Teil seiner Kuriere fest an. Die Unternehmen argumentieren, dass die Fahrer bei den „Partnerunternehmen“ fest angestellt seien. Die Drittunternehmen arbeiteten nicht exklusiv für eine Plattform, sondern für mehrere. Damit treffe der Vorwurf der Scheinselbständigkeit nicht zu. Ähnlich verhalte es sich beim Fahrtvermittlungsgeschäft, meinen Uber und Bolt. Dort seien die Fahrer auch bei privaten Mietwagenunternehmen angestellt. Gewerkschafter halten dagegen, die Fahrer bekämen eben nicht von den Subunternehmern gesagt, wo sie hinzufahren haben, sondern von den Apps. Damit liege die Verantwortung bei den Plattformen.
Fairwork schreibt in seinem Bericht, dass das Subunternehmermodell keine fairen Arbeitsstandards gewährleiste. Zwar würden die Plattformen von den Subunternehmen erwarten, dass diese die Arbeitskräfte in einem Angestelltenverhältnis beschäftigen. Doch die Realität sehe anders aus. Manche Arbeiter seien ganz ohne Vertrag tätig oder würden selbst mit formalem Arbeitsvertrag wie selbständige oder freiberufliche Unternehmer behandelt. Andere mit zeitlich begrenzten Verträgen erhielten informell eine Vergütung für deutlich mehr Arbeitsstunden als im Vertrag angegeben. Die befragten Plattformarbeiter erhielten laut Fairwork oft keine Gesundheits- und Sozialleistungen und seien während ihrer Arbeit nicht versichert.
Wolt teilt auf Anfrage mit, dass man die Bedeutung unabhängiger Bewertungen wie des Fairwork-Rankings zwar anerkenne, in diesem Jahr aber nicht an der Erhebung teilgenommen habe. Die Methoden und Kriterien seien zwar „gut gemeint“, spiegelten aber nicht die „Komplexität und die rechtlichen Beschränkungen unseres Betriebsmodells“ wider. Die direkt beschäftigten Kuriere würden etwa „völlig außer Acht gelassen“. Partnerunternehmen würden umfassend und regelmäßig überprüft. Uber teilt mit, der Bericht stelle durch die Nutzung von Einzelfällen ein verzerrtes Bild der Mietwagen- und Lieferbranche dar. Partner seien vertraglich zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben verpflichtet. „Sofern sie sich nicht an die Regeln halten und wir davon Kenntnis erlangen, ziehen wir entsprechende Konsequenzen, bis hin zu einer Sperrung auf unserer Plattform.“ Ähnlich äußerte sich ein Bolt-Sprecher: „Das Hauptproblem des Fairwork-Ansatzes besteht darin, dass er von einer festgelegten ideologischen Grundannahme ausgeht: Plattformen sollten dem traditionellen Beschäftigungsmodell entsprechen.“ Diese „einseitige Betrachtung“ ignoriere den Wert, den Flexibilität und Unabhängigkeit für viele Arbeitende darstellen.