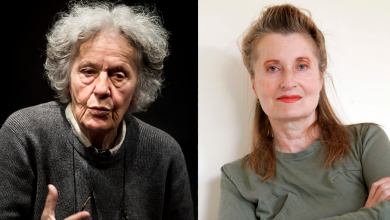Kriminalität: Angst macht starke Politik. Aber selten gute | ABC-Z

Angst ist eine unfaire Gegnerin. Zahlen
und Fakten interessieren sie wenig, sie muss sich nicht bewähren, nichts
beweisen. Wie in Großbritannien, wo ein rechtsradikaler Mob antimuslimische und nationalistische Proteste organisiert, nachdem ein 17-Jähriger verdächtigt worden ist, drei Kinder bei einem Messerangriff getötet zu haben. Es handele sich bei dem Mann um einen Einwanderer, der auf einem Boot nach Großbritannien gelangt sei, hieß es. Nur, in Wahrheit ist der mutmaßliche Täter gebürtiger Brite. Wo sich
Angst ausbreitet, wird es für Argumente eng. Kaum ein Motor, der uns so
zuverlässig antreibt wie sie. Genau dafür schätzen sie viele Politiker,
Demokraten wie Despoten, sie generieren mit ihr Mehrheiten, tragen sie als
Rechtfertigung vor sich her, peitschen mit ihr die Massen auf die Straße, in
die Wahlkabine, auf das Schlachtfeld. Und mit einer besonderen Spielart der
Angst machen sie seit jeher Kriminalpolitik: mit der Angst vor Straftaten. Dank
neuer Studien verstehen wir Kriminalitätsfurcht immer besser. Werden wir auch
schlau aus ihr?
Während
der Pandemie machten zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl
Kriminologie der Ruhr-Universität Bochum eine Entdeckung, die sie im April
dieses Jahres im Onlinejournal Kriminologie veröffentlichten. Seit 2017 hatte ihr
Professor die Studierenden einen Fragebogen ausfüllen lassen, der sowohl das
Sicherheitsgefühl als auch Einstellungen zu Strafen abfragt. Sie sollten
ankreuzen, für wie wahrscheinlich sie es hielten, in den nächsten zwölf Monaten
Opfer bestimmter Delikte zu werden. Schließlich verglichen die Mitarbeiterinnen
die frühen Daten mit denen von 2021. War die Kriminalitätsfurcht vor der
Pandemie noch zurückgegangen und strafmilde Einstellungen verbreiteter
geworden, hatte sich der Wind nun gedreht: Die Angst vor Straftaten stieg an,
die Strafeinstellungen wurden härter. Große gesellschaftliche Veränderungen,
erklären die Wissenschaftlerinnen, könnten andere unbestimmte Ängste anfachen,
die wiederum die Kriminalitätsfurcht steigerten.
Diese
sogenannte Generalisierungsthese ist eine von vielen Erklärungen für
Kriminalitätsfurcht. Und nicht die einzige, die nichts Gutes verheißt in einer
Zeit, in der ein gesellschaftlicher Umbruch auf den nächsten folgt. Fachleute
unterscheiden zwischen der kognitiven und der affektiven Kriminalitätsfurcht,
also der Risikoeinschätzung einerseits und der emotionalen Beunruhigung
andererseits. Außerdem messen sie Verhaltensänderungen, etwa wenn wir nachts
bestimmte Straßen meiden oder uns nur in Begleitung bewegen. Und schließlich
trennen sie die personale Seite, die Angst um sich selbst und das unmittelbare
Umfeld, von der sozialen, die sich auf die Allgemeinheit bezieht. Einige
Erkenntnisse bestätigten sich über die etwa 60 Jahre, seit denen diese Ängste erforscht
werden, immer wieder: Frauen fürchten sich tendenziell mehr als Männer, ältere
Menschen mehr als jüngere. Medienberichterstattung beeinflusst die personale
Furcht nahezu gar nicht, die soziale dafür umso mehr. Einen zwangsläufigen
Zusammenhang zwischen Opfererfahrung und Angst gibt es nicht. Die meisten
Menschen gehen grundsätzlich von einem Anstieg der Kriminalitätsraten aus, doch
diese Überzeugung sinkt, je besser sie das abgefragte Gebiet kennen.
Ständig
finden Forschende neue Zusammenhänge. Die tatsächliche
Hellfeld-Kriminalitätsrate, also
die bekannter Fälle, ist dabei ein bemerkenswert marginaler Faktor, der mal
mit dem Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung korreliert und mal nicht. Wenn
etwa Fußballstar Toni Kroos im Podcast Lanz & Precht verkündet, Deutschland
sei “nicht mehr das gleiche Land wie vor zehn Jahren”, ist das mit Blick auf
die polizeiliche
Kriminalstatistik nur insofern richtig, als dass 2023 weniger Straftaten
erfasst wurden als 2013.
Unerwartete Angstfaktoren
Wie
unerwartet die Angstfaktoren sein können, zeigt der neueste Arbeitsbericht des
soziologischen Instituts der Universität Leipzig vom Mai dieses Jahres.
Kriminologinnen und Kriminologen diskutieren schon seit den Achtzigerjahren die Broken-Windows-Theorie: je vermüllter, kaputter und unordentlicher das
Straßenbild, je mehr zerbrochene Fensterscheiben also, desto mehr Straftaten und
mehr Furcht. Spätestens seit der damalige New Yorker Bürgermeister Rudy
Giuliani 1994 die umstrittene Nulltoleranzstrategie seiner Polizei mit der
Broken-Windows-Theorie begründete, war sie in akademischen Kreisen
gewissermaßen unten durch und als, so heißt es im Leipziger Aufsatz, “grober
Wurf für extreme restriktive polizeiliche Maßnahmen” verschrien. Denn es sind
nicht nur kaputte Scheiben, auf die die Theorie abzielt, sondern alles, was
Soziologen incivilities nennen: der
bettelnde Obdachlose, das Graffito auf dem Bahnwaggon, die herumlungernden
Jugendlichen. Polizeiarbeit, die auf dieser Theorie gründe, sagen Kritiker, führe
geradewegs in den Polizeistaat.
So
einfach ist es dann aber doch nicht. Denn die Leipziger Forscher zeigen, dass
wahrgenommene incivilities die Furcht
vor Straftaten tatsächlich erhöhen – man muss nur der Typ dafür sein. Wer eine
höhere grundsätzliche Präferenz für Ordnung angibt, den ängstigt es schneller,
wenn es mal weniger ordentlich zugeht. Das trifft vor allem auf weniger
gebildete und ältere Befragte zu. Als Ursprung dieser Angst verstärkenden
Ordnungsliebe vermuten die Forscher wiederum Unzufriedenheit mit der eigenen
Kontrolle im Wohnumfeld, also zu wenige Möglichkeiten, die Nachbarschaft
mitzugestalten, geltende Normen mitzubestimmen und auf Normbrüche kollektiv und
informell – ohne Polizei und Justiz – zu reagieren. Wer also meint, selbst
nichts mitgestalten zu können, will sein Umfeld auch nicht von seinen Nachbarn
gestalten lassen.
Das Gefühl, gehasst zu werden
Also
alles subjektiv, alles eine Frage von individuellen Kontrollbedürfnissen und
Ordnungsvorstellungen? Dann hätten wir den Schlüssel, mehr Partizipation, mehr
Angebote zum nachbarschaftlichen Engagement, und schon könnten uns die
zerbrochenen Fensterscheiben nichts mehr anhaben. Doch auch das ist zu kurz
gedacht. Denn eines scheint die Angst stärker zu füttern als Umbrüche und
Kontrollverlust: das Gefühl, gehasst zu werden.
Alle
drei Jahre führt das Bundeskriminalamt (BKA) eine bundesweite Dunkelfeldstudie, also unbekannter Fälle, zu
Opfer-Werdung und ihren Folgen durch. Opfer von Hasskriminalität, warnten die
Forscherinnen schon 2017, fürchteten sich deutlich
mehr vor Kriminalität als Opfer anderer Straftaten. Eine aktuelle Befragung aus
Mannheim zeigt ähnliche Effekte für Opfer von sexistischer und queerfeindlicher
Hasskriminalität.
In
der neuesten BKA-Studie von 2020 scheint sich außerdem eine Art Trickle-down-Effekt der Angst abzuzeichnen. Wer Straftaten gegen die eigene
Gruppe mitbekommt, fürchtet sich offenbar auch selbst mehr.
Angst ist eine unfaire Gegnerin. Zahlen
und Fakten interessieren sie wenig, sie muss sich nicht bewähren, nichts
beweisen. Wie in Großbritannien, wo ein rechtsradikaler Mob antimuslimische und nationalistische Proteste organisiert, nachdem ein 17-Jähriger verdächtigt worden ist, drei Kinder bei einem Messerangriff getötet zu haben. Es handele sich bei dem Mann um einen Einwanderer, der auf einem Boot nach Großbritannien gelangt sei, hieß es. Nur, in Wahrheit ist der mutmaßliche Täter gebürtiger Brite. Wo sich
Angst ausbreitet, wird es für Argumente eng. Kaum ein Motor, der uns so
zuverlässig antreibt wie sie. Genau dafür schätzen sie viele Politiker,
Demokraten wie Despoten, sie generieren mit ihr Mehrheiten, tragen sie als
Rechtfertigung vor sich her, peitschen mit ihr die Massen auf die Straße, in
die Wahlkabine, auf das Schlachtfeld. Und mit einer besonderen Spielart der
Angst machen sie seit jeher Kriminalpolitik: mit der Angst vor Straftaten. Dank
neuer Studien verstehen wir Kriminalitätsfurcht immer besser. Werden wir auch
schlau aus ihr?