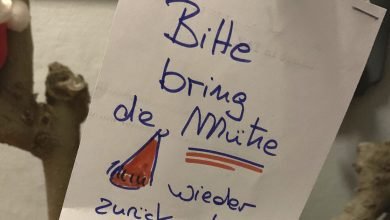Kreuzberger Opfer der Berliner Mauer: Fünf tote Kinder zuviel | ABC-Z

Der Sturz am Kreuzberger Gröbenufer wurde zunächst nicht bemerkt, der gleichaltrige Junge war davongelaufen. Erst Stunden später war die Feuerwehr vor Ort. „Am westlichen Ufer begannen Feuerwehrleute mit langen Stangen die Spree abzusuchen“, hieß es in einer operativen Tagesmeldung der Nationalen Volksarmee NVA.
Zwei NVA-Boote hatten das Geschehen laut Westberliner Polizei aus einer Entfernung von 80 Metern beobachtet. Die Rettungsversuche hätten sie nicht behindert. Allerdings seien sie auch der Aufforderung nicht nachgekommen, selbst bei der Rettung zu helfen. Unmittelbar ans Kreuzberger Ufer zu fahren, war ihnen nicht erlaubt. So sollte das Desertieren von Grenzsoldaten verhindert werden.
Ein Fall schlägt Wellen
Der Fall schlug Wellen. „Sechsjähriger ertrank vor den Augen der Grepos“, titelt am darauffolgenden Tag Springers Boulevardblatt B. Z. Die Berliner CDU, damals in der Opposition, verlangte, „unverzüglich ein Verfahren gegen die Zonen-Grenzposten einzuleiten, die sich an dem Tod des Sechsjährigen mitschuldig gemacht haben.“
War Andreas Senk ein Maueropfer?
Nach einem Sturz ins Wasser, schrieb der Tagesspiegel damals, hätten Rettungskräfte etwa acht Minuten, um einen Menschen zu retten. Im Falle von Andreas Senk wäre also jede Hilfe zu spät gekommen. Als Feuerwehr und NVA an der Unfallstelle waren, war er bereits ertrunken.
Was aber, wenn es jemanden gegeben hätte, der den Jungen hätte retten können? Auf die politische Dimension der Spree als Grenze wies damals Günther Matthes in einem Kommentar im Tagesspiegel hin: „Am Berliner Todesstreifen fehlt es an Passanten, die schnell zu Rettern werden könnten“, schrieb Matthes. „Und wenn sie da gewesen wären, mussten sie nicht damit rechnen, bei einem Sprung in Ost-Berliner Gewässer erschossen zu werden?“
„Das ist die Rhetorik des Kalten Krieges“, sagt Gerhard Sälter zu Zeitungsberichten wie diesem. Der Leiter Forschung und Dokumentation der Stiftung Berliner Mauer gibt zu bedenken, dass es nicht erwiesen sei, dass die Grenzbeamten der DDR in so einem Fall tatsächlich geschossen hätten. „Aber die Westberliner Medien haben das immer wieder geschrieben, sodass es die Leute geglaubt haben.“
Sechs Jahre später wird sich diese Frage in ihrer ganzen Dramatik stellen. Am 30. Oktober 1972 war der achtjährige Cengaver Katrancı beim Spielen in die Spree gefallen. Von Cengavers Freund wurde ein Angler auf die Situation aufmerksam gemacht. Der Angler rannte zur Unfallstelle. „Als er schon begonnen hat, sich zu entkleiden, wird ihm bewusst, dass die Spree hier in ganzer Breite zu Ost-Berlin gehört, und dass er riskiert, bei einem Rettungsversuch von den DDR-Grenzposten erschossen zu werden“, schreibt Udo Baron in „Chronik der Mauer“. „Er springt dem ertrinkenden Kind nicht hinterher.“
Hätte dieses Unglück vermieden werden können? Und wenn ja, mit welchen Maßnahmen?
„Schon nach dem ersten toten Kind hätten der Senat oder auch die Bundesregierung eine Lösung finden müssen“, sagt Safter Çinar vom Türkischen Bund Berlin Brandenburg TBB. „Politik und Ideologie dürfen in so einem Fall keine Rolle spielen. Hier ging es um Menschenleben.“
Andere stellen, wenn auch hinter vorgehaltener Hand, die Frage, ob der Senat ebenso untätig geblieben wäre, hätte es sich nicht um Kreuzberger, sondern um Zehlendorfer Kinder gehandelt.
Es wird verhandelt
Erst als im Mai 1973 der fünfjährige Siegfried Kroboth mit einem Freund nahe der Brommybrücke beim Spielen in die Spree fiel und ertrank, kam Bewegung in die Sache. Der Westberliner Senat und die DDR-Behörden begannen mit Gesprächen über ein Abkommen und mögliche Rettungsmaßnahmen.
Bei Kroboth hatten Westberliner Polizei und Feuerwehr mit zusehen müssen, wie der Junge ertrank. Ein DDR-Grenzboot hatte nicht auf Aufforderungen reagiert, den Jungen zu retten. Der Westberliner Feuerwehrmann Klaus Abraham, damals Rettungstaucher, jetzt Zeitzeuge der Stiftung Berliner Mauer, erinnert sich noch sehr gut an das Gefühl, zeitig vor Ort gewesen zu sein, aber aufgrund der Grenzsituation nicht helfen zu können.
Zum Westberliner Unterhändler wurde Heinz Annußek ernannt, damals als Unterabteilungsleiter der Innenverwaltung zuständig für Polizei und Feuerwehr. Sein Verhandlungspartner auf Ostberliner Seite war der Leiter der „Westberlin-Abteilung“ des DDR-Außenministeriums, Joachim Mitdank.
Trotz des Viermächteabkommens 1971 und des Grundlagenvertrags 1972 gestalteten sich die Gespräche schwierig. „Das lag vor allem an der Forderung der DDR, die Sektorengrenze als Staatsgrenze anzuerkennen“, sagt der Politikwissenschaftler Eckart Stratenschulte.
Aber auch die DDR, seit 1973 Mitglied der UNO, stand unter Druck. Nach dem Tod von Çetin Mert am 11. Mai 1975 war es zu wütenden Proteste seitens der türkischen Community in Kreuzberg gekommen. Bis zu 2.000 Demonstranten versammelten sich am Gröbenufer. Sie riefen „Mörder, Mörder, Kindermörder!“ und verteilen Flugblätter mit Aufschriften wie „Nieder mit der Schandmauer – Nieder mit dem Mörderkommunismus“. Bilder, die unangenehm für das SED-Regime waren, obwohl sie im Neuen Deutschland nicht zu sehen waren.
Nach zwei Jahren kam es schließlich am 29. Oktober 1975 zu einer Einigung. Nicht in Form eines Abkommens, sondern eines Austauschs, eines Notenwechsels. Der sah vor, dass Notrufsäulen errichtet werden, von denen aus die DDR-Grenzer über ein Unglück unterrichtet werden können. Anschließend hätten Feuerwehr und Polizei Verunglückte auch in der Spree retten können.
War es diese Einigung, die dazu führte, dass nach Çetin Mert kein weiteres Kind in der Spree ertrank? Oder war es der Zaun, der inzwischen aufgestellt worden war? Diese Frage ist bis heute offen.
Wenige Tage nachdem Çetin Mert am 11. Mai 1975 gestorben war, ließ der Senat Warnhinweisschilder in deutscher und türkischer Sprache aufstellen. Das berichtete die Berliner Morgenpost am 15. Mai. Gleichzeitig wurden die vier Durchgänge zur Uferböschung zugeschweißt. Vor der Kaimauer wurde ein Maschendrahtzaun aufgestellt.
Für Gülşah Stapel kam das viel zu spät. „Viel zu lange wurde gesagt, ein Zaun wäre eine Art Gegenmauer, mit der Westberlin die Grenze anerkennen würde“, sagt sie. „Warum hat man da nicht viel eher nach einer pragmatischen Lösung gesucht? Die Kinder würden dann vielleicht noch leben.“
Stapel arbeitet für die Stiftung Berliner Mauer in der historisch-politischen Bildung. Zum Gedenktag des Mauerfalls am 9. November bietet sie auch eine türkischsprachige Führung zur Mauer an. Sie ist Teil des Projekts „Berliner Mauer goes … türkçe“.
„Bei einer Probeführung“, sagt Stapel, „war eine Frau dabei, die auch die Demos nach dem Tod von Çetin Mert miterlebt hat“. Dominiert wurden die Proteste damals von nationalistischen und islamistischen Kreisen. „Der Tod des Jungen wurde instrumentalisiert“, sagt Stapel. „Die antikommunistischen Proteste kamen dem Senat nicht unrecht.“
Die Familie von Çetin Mert hat Berlin bald darauf verlassen und ist in die Türkei zurückgekehrt, sagt Stapel. „Auf seinem Grabstein haben sie eingraviert, dass ihr Sohn nicht ertrunken sei, sondern ein Todesopfer der Mauer war.“
Zur Traumatisierung der Familie hat offenbar auch die Überführung des Leichnams beigetragen. Das berichtete der jüngere Bruder von Çetin Mert im Jahr 2000 in einem Interview mit der Berliner Zeitung. 10.000 Mark, sagt Yasar Mert, habe die Familie an die DDR bezahlen müssen, um die Leiche des Jungen Tage später zurück zu bekommen. Eine Entschädigung hätten sie bis heute nicht erhalten.
Für den 50. Todestag im kommenden Jahr will Gülşah Stapel ein würdiges Gedenken organisieren. Und immer auch wieder neue Fragen stellen. „Die Geschichten, die wir hier erzählen, sind vielleicht ambivalenter, als wir denken“, sagt sie und berichtet davon, dass in den Stasiakten auch von einem Provokateur zu lesen war, der in die Spree gesprungen sei. „Der wurde nicht erschossen.“
Zu einer Neubewertung der Ereignisse in Kreuzberg gehört nicht zuletzt die Frage, ob die Grenzer der DDR die Kinder wissentlich oder gar vorsätzlich haben ertrinken lassen. „Dafür gibt es keine Hinweise“, sagt Gerhard Sälter von der Stiftung Berliner Mauer. „Es war wohl eher ein systemisches Versagen, also die Unfähigkeit der Offiziere, vor Ort selbst Entscheidungen zu treffen, ohne sich vorher drei Etagen weiter oben eine Bestätigung zu holen.“