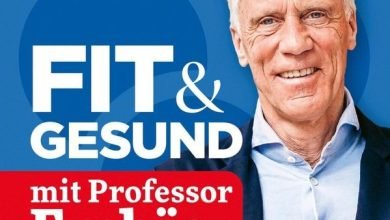Reichstagsgebäude wird per Lichtprojektion erneut “verhüllt” | ABC-Z

Die Bilder des verhüllten Reichstags in Berlin vor 30 Jahren gingen um die Welt. Eine Lichtprojektion erinnert seit Montagabend an die spektakuläre Kunstaktion.
Anlässlich des 30. Jahrestages der Verhüllung des Reichstags durch das Künstler-Ehepaar Christo und Jeanne-Claude wird das Reichstagsgebäude in Berlin ab Montag jeden Abend illuminiert.
Die riesige Lichtprojektion des verhüllten Reichstags ist bis zum 20. Juni täglich an der Westfassade des Gebäudes zu sehen. Projiziert wird jeweils nach Einbruch der Dunkelheit ab etwa 21:30 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht.
24 Hochleistungsprojektoren bringen die Projektion auf die Fassade. Diese stünden auf insgesamt drei Gerüsttürmen in 3 bis 3,5 Meter Höhe und 80 Meter weit vom Reichstagsgebäude entfernt, sagte der technische Leiter, Andreas Boehlke, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.
Das Projekt koste etwa eine halbe Million Euro, sagte kürzlich Kulturmanager Peter Schwenkow, der – wie auch vor 30 Jahren schon – gemeinsam mit dem Unternehmer Roland Specker maßgeblich beteiligt ist. Die Kosten würden von der Stiftung von Christo und Jeanne-Claude, welche Christos Neffe Vladimir Yavachev leitet, von Specker und ihm selbst getragen, sagte Schwenkow. Mit der Inszenierung sollten Berlin, die Wiedervereinigung, die Demokratie und die Kunst gefeiert werden, hieß es.
Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) hatten vor 30 Jahren nach viel Überzeugungsarbeit die Genehmigung bekommen, das Reichstagsgebäude 1995 zu verhüllen – kurz vor dem Umbau zum Sitz des Bundestags und noch ohne die charakteristische Glaskuppel. Sie verpackten das Gebäude mit 100.000 Quadratmeter silbrig-glänzendem Gewebe. Die 14-tägige Aktion hatte hunderttausende Besucher angelockt. Die Bilder vom “Wrapped Reichstag” gingen um die Welt.
Am 13. Juni wäre auch der 90. Geburtstag des Künstler-Ehepaares gewesen, beide waren am 13. Juni 1935 geboren worden.
Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Textes hieß es, der Reichstag sei mit einer Folie verhüllt worden. Das war nicht korrekt. Das Gebäude wurde mit einem Gewebe verhüllt. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.
Sendung: rbb24 Abendschau, 09.06.2025, 19:30 Uhr