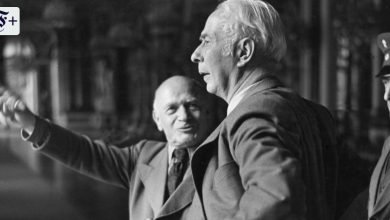Konklave, zweiter Tag: Machen Geldprobleme des Vatikans einen Deutschen zum Papst? | ABC-Z

Konklave, zweiter Tag
Machen Geldprobleme des Vatikans einen Deutschen zum Papst?
08.05.2025, 11:33 Uhr
Artikel anhören
Diese Audioversion wurde künstlich generiert. Mehr Infos
Der neue Papst wird sich mit den maroden Finanzen des Vatikans herumschlagen müssen. In Deutschland geht es Bistümern dagegen viel besser. Hat deshalb ein Deutscher Chancen auf den Heiligen Stuhl?
Eigentlich galten die deutschen Kardinäle als aussichtslos im Konklave. Einige Italiener sollen “papabile”, also papstfähig, sein oder ein Kardinal aus Manila. Doch dann zählt die britische BBC auf einmal einen Deutschen zum Favoritenkreis: Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx soll Chancen auf den Heiligen Stuhl haben. Werden wir Papst?
Der Grund für Marx’ angeblichen Aufstieg: Er gilt als jemand, der mit Geld umgehen kann. Marx ist Koordinator des Wirtschaftsrats des Vatikans und hatte vor wenigen Tagen die Aufgabe, den päpstlichen Haushalt zu präsentieren. Die Zahlen sollen katastrophal gewesen sein. Das Defizit des Heiligen Stuhls stieg laut Medienberichten in den vergangenen Jahren deutlich an und soll 2024 um die 87 Millionen Euro betragen haben. Selbst mit deutlichen Einsparungen sei das Problem nicht zu lösen, zitiert die italienische “La Repubblica” einen nicht namentlich genannten Kardinal: “Es bräuchte vielmehr ein Wunder.”
Reinhard Marx hingegen residiert über ein Bistum, das als eines der reichsten in Deutschland gilt. Das Erzbistum München-Freising weist für das Jahr 2023 einen Jahresüberschuss von 19 Millionen Euro aus, die Bilanzsumme beträgt fast 4 Milliarden Euro. Das ist zwar deutlich weniger als noch im Jahr zuvor, in Zeiten sinkender Kirchensteuereinnahmen allerdings noch ordentlich. Neben seinem Einfluss als ehemaliger Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz und als Berater von Papst Franziskus soll dieses Argument Marx “papabile” machen. Doch wie viel Geld haben München-Freising und die anderen 26 deutschen Bistümer wirklich?
Kirchen sind anders als staatliche Behörden nicht dazu verpflichtet, ihre Finanzen offenzulegen – auch wenn sie Steuergelder erhalten. Nach Finanzskandalen in den Bistümern Limburg und Freiburg hat die Bischofskonferenz allerdings mehr Transparenz versprochen. Die Bistümer verpflichteten sich vor einigen Jahren, eine kaufmännische Buchführung einzuführen und Jahresabschlüsse prüfen zu lassen und zu veröffentlichen. Finanziell genießen Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts gewisse Privilegien in Deutschland: Sie müssen keine Körperschafts- und Gewerbesteuer zahlen.
Nicht alle schreiben schwarze Zahlen
Das meiste Geld der Bistümer fließt laut der Bilanzen in Personalkosten, außerdem in Bildung und soziale Dienste. Wichtigste Einnahmequelle ist die Kirchensteuer, hinzu kommt Geld aus Spenden sowie aus Aktien-Anlagen und Immobilienfonds, in die die Kirchen investieren. Nicht zuletzt sind die Bistümer auch an Unternehmen beteiligt: Die Gesellschafter der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft sind laut Handelsregister die Bistümer Köln, Paderborn, Trier, Münster, Essen und Aachen. Laut Bilanz verfügte das Unternehmen zum Ende des Jahres 2023 über 760 Millionen Euro Eigenkapital. Eine hundertprozentige Tochter der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft vermietet in ganz Deutschland Gewerbeimmobilien – teils in Top-Lagen wie am Münchner Stachus oder am Berliner Ku’damm.
Auch deshalb gelten die Bistümer Köln und Paderborn neben München-Freising als besonders gut betucht. Zahlen aus dem Jahr 2020 legen nahe, dass Paderborn mit einem Gesamtkapital von über 7 Mrd. Euro das reichste deutsche Bistum ist. Für das Jahr 2023 weist die Bilanz fast 4 Mrd. Euro Eigenkapital und 4,8 Mrd. Euro Anlagevermögen aus. Das Erzbistum Köln kommt im Jahr 2023 auf rund 2,8 Mrd. Euro Eigenkapital und machte rund 5 Mio. Euro Gewinn – zehn Jahre zuvor hatte das Gesamtvermögen laut Medienberichten bei etwa 3,35 Mrd. Euro gelegen.
Nicht alle Bistümer schreiben aber schwarze Zahlen. In Dresden-Meißen weist die Bilanz für das Jahr 2022 einen Verlust von mehr als 2 Millionen Euro aus. Zuschüsse an die ostdeutschen Bistümer aus dem Westen wurden in den vergangenen Jahren reduziert, ab kommendem Jahr sollen sie ganz wegfallen. “Unser Bistum wird in Zukunft mit weniger Finanzmitteln auskommen müssen”, sagte Bischof Timmerevers laut “Sächsischer Zeitung” bereits im Jahr 2023.
Dass die Zahlen so unterschiedlich und trotz versprochener Transparenz undurchsichtig sind, liegt auch daran, dass das gesamte Vermögen der Bistümer schwer zu bestimmen ist. Schließlich haben auch die Caritas, Ordensgemeinschaften und andere Organisationen unter dem Dach der Kirche eigene Haushalte und Vermögenswerte. Insbesondere Grundstücke sind oft im Besitz der Kirchengemeinden vor Ort.
Kirchensteuereinnahmen sinken
Ein großes Fragezeichen schwebt auch über dem Wert der Immobilien, die teilweise seit Jahrhunderten in Kirchenbesitz sind. Ein berühmtes Beispiel ist der Kölner Dom: In den Büchern steht dieser mit nur 27 Euro. Ein symbolischer Wert, für jede Parzelle, auf der der Dom steht, plus 1 Euro für das gesamte Gebäude. Der echte Wert des Doms – mit all den Kunstwerken darin – ist kaum schätzbar. Daran zeigt sich, dass die Bistümer selbst nicht immer genau wissen, wie viel Vermögen sie besitzen.
Der Politologe und Kirchenkritiker Carsten Frerk hatte vor rund 20 Jahren einen Versuch gemacht, die Werte für Grundbesitz, Geldanlagen, Immobilien und Beteiligungen der katholischen Kirche zu summieren. Sein Ergebnis: rund 270 Milliarden Euro Vermögen. Allerdings gab auch er zu, dass genaue Zahlen zum Kirchenvermögen kaum zu errechnen sind.
Für die kommenden Jahre rechnen die Bistümer allerdings mit weniger Geld, auch wegen steigender Kirchenaustritte. Allein in München-Freising seien die Kirchensteuereinnahmen deswegen im Jahr 2023 um 41 Millionen Euro zurückgegangen. Finanzdirektor Markus Reif war bei der Vorstellung der Zahlen “eher pessimistisch”, was die weitere Entwicklung angeht. Um die Rückgänge abzufedern, könne es auch “Einschnitte im Gebäudebereich” geben.
Ob das den Erzbischof Reinhard Marx wirklich zum Papst qualifiziert, können nur die Kardinäle entscheiden. In kirchlichen Medien jedenfalls gilt Marx nicht als Favorit. Ippen Media allerdings zitiert einen Kardinalskollegen, der Marx “die ganze Zeit lächeln” sehe.