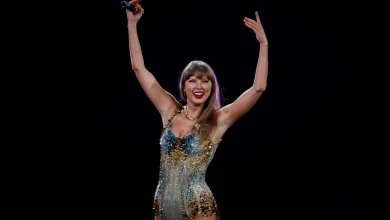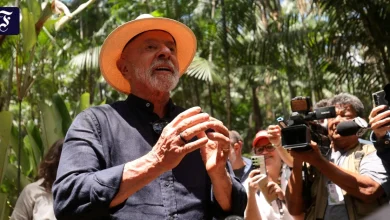Kohlendioxid-Speicherung: Erlaubnis für CCS ist ist kein Geschäftsmodell | ABC-Z

Gute Politik ist dazu in der Lage, sich selbst zu korrigieren, wenn sich Instrumente als unwirksam erweisen. Insofern handelt es sich um einen Akt der Vernunft, dass die unterirdische Speicherung und der Export klimaschädlichen Kohlendioxids fortan nicht länger verboten ist. Aufatmen können vor allem jene Wirtschaftszweige, in deren Herstellprozessen das Klimagas unvermeidbar freigesetzt wird, allen voran die Zementindustrie. Auch manches Stadtwerk, das in der Vergangenheit in Müllverbrennungsanlagen investiert hat, dürfte sich erleichtert zeigen.
Der Illusion allerdings, dass die grundsätzliche Erlaubnis, Technologien für Abscheidung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) einzusetzen, sofort zu Emissionsminderungen führt, sollte sich niemand hingeben. Denn zuvor sind noch einige Hürden zu beseitigen.
Die erste und in der physischen Welt wichtigste Hürde besteht darin, ein Transportnetz für Kohlendioxid zu schaffen. Technisch ist das, sagen Fachleute, keine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Anders als Wasserstoff ist Kohlendioxid ein äußerst reaktionsträges Gas, theoretisch könnten daher sogar existierende Erdgas-Pipelines umgewidmet werden. Da die jedoch vorerst weiter gebraucht werden, ist der Aufbau einer neuen Infrastruktur notwendig.
Komplizierter als der Aufbau des Wasserstoffnetzes
Privatwirtschaftliche Investoren stünden hierfür voraussichtlich bereit, sie benötigen jedoch ein funktionierendes Anreizsystem, aus dessen Gestaltung sich der Staat nicht gänzlich zurückhalten kann. In zweierlei Hinsicht könnte das komplizierter werden als der Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes. Die Betriebsstruktur in den betroffenen Industriezweigen ist dezentraler, das Leitungsnetz müsste mithin dichter werden. Auf 3500 Kilometer Gesamtlänge schätzt der Gasnetzbetreiber OGE den Bedarf. Zudem ist das Image des Kohlendioxids schlecht, lokaler Widerstand gegen die Röhren mithin wahrscheinlicher.
Noch höher liegt die zweite Hürde, sie ist betriebswirtschaftlicher Natur. Die Kosten, um eine Tonne CO2 abzuscheiden, zu reinigen, abtransportieren zu lassen und in Nordeuropa einzuspeichern, liegen aktuell etwa um den Faktor zehn höher als für die Entsorgung des Klimagases in der Atmosphäre. Dies gilt zudem nur für den Fall, dass die betroffenen Unternehmen nicht länger kostenlose CO2-Emissionszertifikate zugeteilt bekommen. Ein immer wieder diskutiertes Aufweichen des Fahrplans für den europäischen Emissionshandel schafft zusätzliche Unsicherheit. Nun stehen die Technologien für die Abscheidung von CO2 erst am Anfang ihres Lebenszyklus, eine erhebliche Kostendegression ist bei großtechnischer Umsetzung zu erwarten. Doch für das einzelne Unternehmen mag die Hürde für eine konkrete Investitionsentscheidung aktuell noch zu hoch sein.
Ob Kohlendioxid im Inland gespeichert werden darf, bleibt offen
Eine weitere Komplikation, die mit der Reform des CCS-Gesetzes nicht beseitigt wurde, liegt in der föderalen Struktur der Bundesrepublik. Ob Kohlendioxid nämlich auch auf dem Festland im Boden gespeichert werden darf und zu welchen Bedingungen, sollen die Bundesländer entscheiden. Kostengünstiger wäre eine solche Lösung vermutlich, aber welcher Ministerpräsident wagt wohl den Vorschlag, Produktionsabfälle – um nichts anderes handelt es sich bei industriellem CO2 – im eigenen Land zu deponieren?
Für die Dimensionierung der Speicher wie der Transportnetze nicht unerheblich ist zudem die Frage, inwieweit Kohlendioxid künftig als Rohstoff genutzt werden wird. Ohne Kohlenstoff, das wird leicht vergessen, ist es nicht möglich, Kunststoffe oder auch synthetische Kraftstoffe für Flugzeuge, Schiffe und militärisches Gerät herzustellen. Bislang stammt der Kohlenstoff dafür aus Erdöl oder Erdgas. Wenn fossile Rohstoffe eines Tages nicht mehr genutzt werden sollen oder können, erhalten sogenannte CCU-Technologien (Carbon Capture and Usage) erhebliches Gewicht. Sie verschieben aber das Mengengerüst und damit auch die Kostenstruktur für den CCS-Einsatz.
Aktuell sind Investitionen in CCS in Summe mit erheblichen Risiken verbunden. Eine Erlaubnis ist eben noch kein Geschäftsmodell. Gute (Wirtschafts-)Politik sollte die weitere Ausgestaltung des Rahmens daher ebenfalls im Auge haben. Dafür gibt es, neben der Pflicht, bestimmte Klimaziele zu erreichen, einen weiteren guten Grund: Deutsche Unternehmen gehören, was den Bau von Anlagen zur Abscheidung, Aufreinigung und Komprimierung von CO2 betrifft, derzeit zur Weltspitze. Eine solche Position ohne Anwendung im Heimatmarkt zu halten, dürfte schwierig werden.