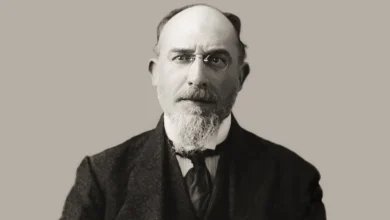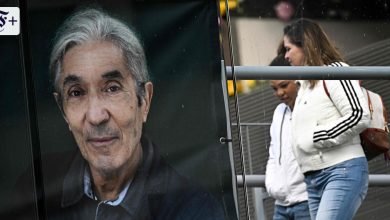Klimarat: Klimaneutralität 2045 wird verfehlt | ABC-Z

Klimawissenschaftler fordern die neue Bundesregierung dazu auf, die Anstrengungen zur Treibhausgasminderung zu verstärken, vor allem langfristig. Ansonsten sei das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 nicht zu schaffen. Die Klimapläne der schwarz-roten Koalition halten die Forscher für zu vage.
Die bisher geltenden gesetzlichen Planungen zu den Klimaschutzprogrammen bis 2040 seien zu kurz gedacht, monierte der Expertenrat für Klimafragen am Donnerstag in Berlin. Dort legte er seinen Prüfbericht zu den Berechnungen der deutschen Emissionen für das Jahr 2024 und für die längerfristigen Projektionsdaten vor. Das Gremium der fünf Sachverständigen unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen besitzt laut Klimaschutzgesetz einen gesetzlichen Auftrag zur Datenüberprüfung.
Der Rat bestätigte, dass die vom Umweltbundesamt UBA vorgelegten Berechnungen für 2024 nachvollziehbar seien. Der Gesamtausstoß von Kohlendioxidäquivalenten sei im gesetzlichen Rahmen geblieben, doch hätten der Gebäude- und der Verkehrssektor zum wiederholten Male die zugebilligten Jahresemissionsmengen überschritten. Die Überschreitung sei in beiden Feldern sogar höher gewesen als im Vorjahr 2023.
Verpflichtung geht nicht weit genug
Gemäß den geprüften Projektionsdaten für den Zeitraum 2021 bis 2030 werde das vorgeschriebene Emissionsbudget zwar eingehalten. Damit liege keine gesetzliche „Zielverfehlung“ zum zweiten Mal hintereinander vor, weshalb auch keine zusätzlichen Klimaschutzprogramme zur „Nachsteuerung“ nötig würden.
Allerdings sei vorgeschrieben, dass eine neue Bundesregierung innerhalb von zwölf Monaten nach Beginn der Legislaturperiode ohnehin ein Klimaschutzprogramm vorlegen müsse. Dieses habe Wege aufzuzeigen, um die bereits festgestellten Zielverfehlungen bis zum Jahr 2040 auszubügeln. Den Fachleuten geht diese Verpflichtung jedoch zeitlich nicht weit genug. Sie fordern, in dem neuen Programm auch die erwartbaren Überschreitungen bis 2045, dem Jahr der angestrebten Treibhausgasneutralität, anzugehen.
Der vom UBA erwartete Treibhausgasausstoß zwischen 2021 und 2030 ist den Angaben zufolge weitgehend plausibel. Die Projektion habe zunächst ergeben, dass das zulässige Emissionsbudget in diesem Zeitraum um 81 Megatonnen unterschritten werde („Puffer“). Die Überprüfung zeige jedoch, dass die Berechnungen „die Emissionsmengen bis 2030 tendenziell unterschätzen“ und zwar in Größenordnung des Puffers. Somit werde die zulässige Gesamtsumme weder unter- noch überschritten.
Einhaltung nur durch Corona-Effekt
Überdies sei der Erfolg ein relativer, gab der Vorsitzende des Expertenrats, Hans-Martin Henning, zu bedenken. Er ist Physiker, Professor für Solare Energiesysteme an der Universität Freiburg und Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE. „Ohne den Puffer, der sich in den Jahren 2021 bis 2024 unter anderem durch Corona und die schwache Wirtschaft aufgebaut hat, wäre bis Ende 2030 mit hoher Wahrscheinlichkeit eine deutliche Budgetüberschreitung zu erwarten gewesen“, sagte Henning.
Zudem verfehle Deutschland seit 2024 seine Verpflichtungen unter der Lastenteilung der EU (Burden Sharing). Die bis 2030 berechnete europäische „Ziellücke“ habe sich gegenüber dem Vorjahr noch ausgeweitet. Desgleichen werde auch die von Deutschland angestrebte Reduktion aller Treibhausgase um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 nicht erreicht, kritisierte der Energieforscher.
Besonderes Kopfzerbrechen bereiten den Wissenschaftlern die Entwicklungen nach 2030, vor allem jene des Waldes. Die Klimaziele würden zwischen 2030 und 2045 deutlich „und im Zeitverlauf zunehmend“ gerissen. Die Projektionsdaten illustrierten, dass sich das Betrachtungsfeld „Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft“ (LULUCF), das bisher als sogenannte Senke mehr Treibhausgas aufnehme als abgebe, ins Gegenteil verkehre und zu einer Nettoquelle für Emissionen werde. Diese Entwicklung gehe auch nach 2045 weiter. „Grund dafür ist der schlechte Zustand des Waldes“, schreiben die Gutachter.
Klimaneutralität 2045 wird verfehlt
Ohne LULUCF werde Deutschland in jenem Schlüsseljahr noch immer 204 Megatonnen CO2-Äquivaltente ausstoßen. Mit LULUCF sei sogar mit noch mehr Emissionen zu rechnen. „Das übergreifende Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045 würde damit sehr deutlich verfehlt“, warnt der Bericht. „Net Zero“ lasse sich nur erreichen, wenn Land und Wälder wieder ihrer natürlichen Senkungsfunktion nachkommen und wenn technische Senken die Restemissionen ausgleichen könnten. Der Einsatz solcher „negativer Emissionstechnologien“, welche das Kohlendioxid aus der Luft ziehen, sei jedoch „mit zahlreichen Unwägbarkeiten verbunden“. Ähnlich unsicher sei, wie sich die natürlichen Senken reaktivieren ließen.
Der Expertenrat empfiehlt deshalb, in das Klimaschutzgesetz ein eigenständige Restemissionsziel bis 2045 aufzunehmen. Nötig sei eine Langfriststrategie für das Zusammenspiel des LULUCF-Sektors mit den technischen Senken, regte Ratsmitglied Marc Oliver Bettzüge an. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, wie die Bundesregierung das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045 erreichen will“, monierte der Ökonom. Er ist Professor für Energiewirtschaft an der Universität Köln und Direktor des dortigen Energiewirtschaftlichen Instituts EWI.
Das bis März 2026, ein Jahr nach Beginn der Legislaturperiode, zu erwartende Klimaschutzprogramm der neuen Regierung muss nach Ansicht der fünf Hochschullehrer neben den Senken noch weitere Schwerpunkte setzen. Dazu gehörten zum Beispiel besondere Maßnahmen im Verkehrs- und Gebäudesektor sowie die nationale Umsetzung des zweiten Europäischen Emissionshandels ETS 2.
Die Vereinbarungen von Union und SPD kommen bei den Forschern nicht gut an. „Vom Koalitionsvertrag geht kein nennenswerter Impuls für die Zielerreichung im Jahr 2030 aus“, stellte die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf fest. Die Physikerin und Klimawissenschaftlerin ist Gründerin der Denkfabrik Zukunft Klima-Sozial. „Der Koalitionsvertrag adressiert die maßgeblichen Problemfelder nicht explizit und bleibt an vielen Stellen vage“, so Knopf. Das Expertengremium rate dazu, das anstehende Klimaschutzprogramm nicht nur auf die Ziele für 2030 auszurichten, sondern auch auf die langfristige Erreichbarkeit der Klimaneutralität.