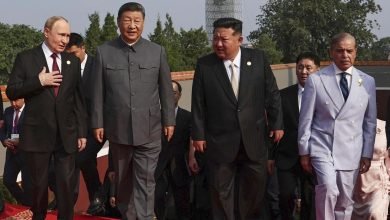Warum nur wenige Asylsuchende psychotherapeutisch behandelt werden | ABC-Z

Psychotherapie für Asylsuchende
–
Viele Traumata von Geflüchteten bleiben unbehandelt
So 31.08.25 | 14:42 Uhr | Von
Zahlreiche Geflüchtete gelten als traumatisiert. Durch Erfahrungen im Heimatland oder während der Flucht. Rund 30 Prozent bräuchten psychotherapeutische Beratung, sagen Untersuchungen. Doch es gibt kaum Angebote für sie. Von C. Gerling und A. Herr
Robina Karimi kam 2017 als 16-Jährige aus Afghanistan nach Deutschland. “Es war sehr traurig für mich und es war sehr viel Last auf meinen Schultern.” Sie kam allein ohne ihre Familie, erzählt sie. “Da habe ich mir gesagt, ich brauche jemanden, umdarüber zu sprechen.”
Benedikt Aink kümmert sich um Menschen wie die junge Afghanin. Der Psychologe berät für den Potsdamer Verein “Komm Mit” Geflüchtete. Viele, mit denen er zu tun hat, haben Schlimmes erlebt, sagt er. “Unsere Klient*innen sind teilweise schon im Herkunftsland traumatischen Erlebnissen ausgesetzt gewesen, sind teilweise während der Flucht traumatisiert worden”, sagt er. “Zum Teil sind Dinge in Deutschland geschehen, die Lebensumstände haben gesundheitliche Problementwicklung begünstigt.”
Die Erfahrungen reichen von Bombardements in Kriegsgebieten, dem Verlust von Freunden und Angehörigen oder Misshandlungen bis zu Folter. Das Leben in Deutschland ist für viele von einem Mangel an Privatsphäre in den Gemeinschaftsunterkünften geprägt, oft verbunden mit der Trennung von der Familie oder einer unsicheren Aufenthaltssituation.
Jedes Jahr werden rund 1.000 Menschen betreut
Als psychosoziales Zentrum mit zehn Beratungsstellen in ganz Brandenburg ist “Komm Mit” ein zentraler Ansprechpartner für Geflüchtete im Land, die Hilfe brauchen. Bei den rund 1.000 Menschen, die jährlich betreut werden, geht es um Unterstützung bei Anträgen, mal um rechtliche Beratung. Etwa die Hälfte von ihnen hat aber auch psychische Probleme. Posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen oder Angststörungen etwa.
30 Prozent der Geflüchteten in Deutschland bräuchten eine Psychotherapie. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Vereins “Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer”.
Joachim Rüffer, Vorstandsvorsitzender von “Komm Mit”, schätzt, dass nur ein knappes Sechstel dieser Gruppe in Brandenburg versorgt werden kann. Sein Verein kann in Potsdam beraten, eine einfache Diagnostik durchführen und den Bedarf ermitteln. Diejenigen, die eine Psychotherapie benötigen, sollen danach zu niedergelassenen Psychotherapeuten vermittelt werden. Doch das ist fast unmöglich, sagt er.
Drei speziell geschulte Mitarbeiterinnen in Teilzeit
“Die Psychotherapeuten sind durch die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung weitestgehend ausgelastet”, sagt Rüffer. “Dazu kommt, dass die Arbeit mit Geflüchteten besondere Anforderungen hat. Beginnend mit den sprachlichen Fragen.” Die Situation im Heimatland müsse mit einbezogen werden, ebenso die Folgen eines Lebens in Gemeinschaftsunterkünften. Ihm sei aus Brandenburg kein Fall bekannt, in dem ein Geflüchteter bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten in Behandlung wäre.
In den Beratungsstellen sind drei Mitarbeiterinnen in Teilzeit tätig: eine ärztliche Psychotherapeutin und zwei psychologische Psychotherapeutinnen. Durch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg sind sie ermächtigt, Therapien mit Geflüchteten durchzuführen. Behandeln dürfen sie nur Menschen, für die das Asylbewerberleistungsgesetz gilt und sich seit mindestens drei Jahren in Deutschland aufhalten.
Immer wieder gibt es auch Versuche, Klienten:innen an spezialisierte Zentren in Berlin zu vermitteln wie “Zentrum Überleben” oder “Xenion”. Doch auch hier sind die Ressourcen begrenzt und Kapazitäten gering. Robina Karimi, die vor acht Jahren aus Afghanistan geflüchtet war, bekam Hilfe bei “Xenion”. Mittlerweile ist sie als Sprachmittlerin in dem psychosozialen Zentrum tätig. “Man braucht diese Hilfe, weil manche Menschen, die allein nach Deutschland oder Europa kommen, verlieren ihr Ziel.”
Das Erlebte Stück für Stück ergründen
Janina Meyeringh, Kinder- und Jugendtherapeutin und Teil der Geschäftsleitung der Einrichtung, sagt, dass in der Regel nur Menschen aufgenommen werden können, die sich in akuten Krisen befinden. Allein für therapeutische Angebote bekämen sie wöchentlich um die 50 Anfragen. “Wenn wir das vergleichen mit denen, die wir dann auch behandeln, dann ist das nur ein Viertel, das dann auch in der Behandlung ankommt”, sagt Meyeringh. “Das ist natürlich dramatisch.”
Problembehaftet ist jedoch die Finanzierung solcher Angebote. “Wir könnten sehr viel mehr Menschen versorgen, wenn wir nicht jedes Jahr neu darum kämpfen müssten, unsere Arbeit weiter zu finanzieren”, sagt sie. Von der Politik wünscht sie sich mehr Weitsicht, denn die Unsicherheit habe konkrete Auswirkungen für ihr Angebot: “Weil wir dann Stellen teilweise nicht besetzen können, wenn wir nicht wissen, ob die Stellen finanziert sind.”
Robina Karimi erzählt von einem Bekannten, der nicht wusste, wie er seine Erlebnisse verarbeiten soll. “Viele Menschen sind vor seinen Augen gestorben, im Wasser ertrunken. Unterwegs hat er die gestorbenen Körper gesehen.” Abhilfe habe er einzig in Ablenkungen gefunden. “Dann denkt er, der einzige Weg, dass ich das von meinem Kopf wegkriege, ist nur die Zigarette und andere Sachen.” Deshalb sei es sehr wichtig Stück für Stück zu ergründen, was Menschen wie er erlebt haben,sagt sie. Um so Wege aus belastenden Gedankenwelten zu finden.
Neben dem individuellen Problem sieht Joachim Rüffer auch eines für die Allgemeinheit: “Wir wissen im Grunde, dass solche depressiven Zustände können begleitet sein von Suchterkrankung und nicht offen sein für den Arbeitsmarkt. Und damit gibt es eine deutliche Belastung für die Gesamtgesellschaft.”
Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 31.08.2025, 19.30 Uhr