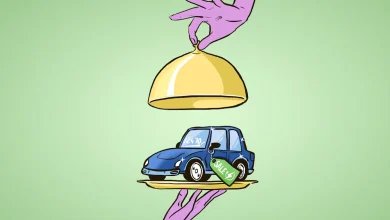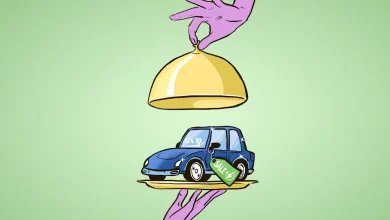So verändert sich der Modal Split | ABC-Z

Deutschland erlebt einen tiefgreifenden Wandel im Güterverkehr: Der sogenannte Güterstruktureffekt verschiebt die Transportmengen von Massengütern zu kleineren, spezialisierteren Sendungen. Intermodale Transporte und Container-Ladungen wachsen stark, während traditionelle Güter wie Kohle, Rohöl oder Metalle zurückgehen. Der Modal Split zeigt klare Trends: Die Straße bleibt dominant, die Schiene kann in bestimmten Segmenten zulegen, die Binnenschifffahrt verliert. Um die Klimaziele zu erreichen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, muss mehr Verkehr auf die Schiene verlagert werden. Eng vernetzte Lieferketten, Terminals mit Punkt-zu-Punkt-Verkehren und modulare Güterwagen sind Schlüssel, um die Potenziale der Schiene zu heben. Prognosen bis 2040 zeigen, dass ein strategischer Ausbau der Schienenkapazitäten entscheidend ist, um den Güterverkehr nachhaltiger und effizienter zu gestalten.
Dieser Inhalt gehört zu
Als VerkehrsRundschau-Abonnent haben Sie kostenfreien Zugriff.