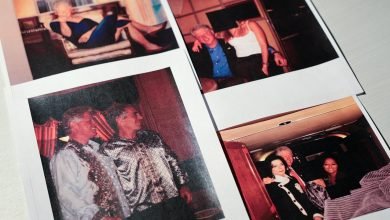Ist Migration der Grund für die Bildungskrise? Neue Studie klärt auf | ABC-Z

Bilungskrisekrise wegen Migration? Der Sozialforscher Andreas Herteux analysiert, warum sie eine Rolle spielt, aber nur Teil der Herausforderung ist.
„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir“, das sagte bereits der Philosoph Seneca zu seinen römischen Zeitgenossen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Doch nun gibt es mal wieder eine Diskussion. Die wird durch eine aktuelle Studie angeregt, den IQB-Bildungstrend. Darin wird eine negativen Leistungstendenz im deutschen Schulsystem aufgezeigt.
Doch wie sieht es wirklich aus? Handelt es sich um eine flächendeckende Herausforderung? Ragen manche Bundesländer positiv oder negativ heraus?
Migration: Daten und Fakten aus neunten Klassen in Deutschland
Als Grundlage soll zunächst die angesprochene Erhebung genutzt werden, die sich den Kenntnissen von Neuntklässlern in Mathematik und Naturwissenschaften gewidmet hat. Demnach lag der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund in der untersuchten Jahrgangsstufe bei ca. 40 Prozent. Das sind gut 7 Prozent mehr als noch im Jahr 2018.
In Bremen, Berlin, Hamburg und Hessen hat inzwischen – bei steigender Tendenz – mehr als die Hälfte der Kinder in der genannten Jahrgangsstufe eine Einwanderungsgeschichte. Knapp 13 Prozent der Schüler gehörten dabei der sogenannten ersten Generation an, d. h., die Jugendlichen wurden im Ausland geboren und sind anschließend eingewandert – mindestens ein Drittel davon aus einem Fluchtkontext.
Entsprechend waren bei Ankunft oft keine Sprachkenntnisse oder gesellschaftlichen Kenntnisse vorhanden. Auch die schulische Ausbildung im Herkunftsland gestaltete sich vermehrt als lückenhaft – sei es durch Krieg, Armut oder ein schwach ausgeprägtes Bildungssystem.
Die sogenannte zweite Generation wurde zwar in Deutschland geboren, allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass das Umfeld auch von bildungsfördernden Einflüssen geprägt ist.
Grundsätzlich gilt natürlich, dass eine weitere Differenzierung interessant gewesen wäre, diese aber nicht vorliegt. Beide Gruppen verfügen daher häufig bereits durch ihr Umfeld über keine idealen Voraussetzungen.
Die soziale Lage spielt hierbei eine herausragende Rolle, und der Migrationshintergrund ist in diesem Kontext zweifelsfrei ein prägendes Element.
Die Diskrepanzen im Leistungsbereich sind eklatant
Bei den jüngsten IQB-Erhebungen zeigten sich daher signifikante Unterschiede zu Mitschülern ohne Zuwanderungsgeschichte: Die erste Generation lag sowohl in Mathematik, Biologie, Chemie als auch in Physik deutlich zurück.
Die Diskrepanzen sind eklatant – häufig bereits deshalb, weil grundlegende Sprachkenntnisse fehlen. Und diese sind nun einmal die Eintrittskarte in die Welt des Verstehens und Lernens.
Auch bei der zweiten Generation waren deutliche Abweichungen messbar: Sowohl zur ersten Generation als auch zur Gruppe ohne Migrationshintergrund. Zwar immer noch merklich schwächer als die Vergleichsgruppe ohne Einwanderungsgeschichte, aber augenscheinlich besser als die Jugendlichen, die im Ausland geboren wurden.
Im Kern, und das ergibt sich auch aus anderen Erhebungen wie PISA, schneiden damit aber beide Gruppen schlechter ab als die übrige Vergleichspopulation. Das sind erst einmal die nüchternen, wenngleich auch erklärbaren Fakten.
Ist Migration für den Absturz des deutschen Bildungssystems verantwortlich?
Ist Migration also für den Absturz des deutschen Bildungssystems verantwortlich? Dass sie einen Faktor darstellt, bleibt unbestreitbar, jedoch gestaltet es nicht ganz so einfach, denn der Abwärtstrend in den Leistungen zeigt sich in allen drei Gruppen, und zwar unabhängig von sozialer Lage oder Zuwanderung.
Oder einfacher gesagt: Auch die Schüler ohne Zuwanderungsgeschichte in Gebieten, in denen die beiden Elemente kaum eine Rolle spielten, zeigen eine Negativentwicklung.
Tatsächlich fielen die Mittelwerte bundesweit zwischen 2018 und 2024. Oder vereinfacht zusammengefasst: Knapp 34 Prozent aller Neuntklässler verfehlten 2024 den Mindeststandard in Mathematik, in Chemie waren es, für die Teilgruppe, die mindestens den MSA anstrebt, 25 Prozent, und in Physik 16 Prozent.
Oben liegen fast immer Bayern und Sachsen
Es scheint daher keine monokausale Erklärung zu geben, sondern die Entwicklung offeriert sich weitaus vielfältiger. Das wird bereits deutlich, wenn einzelne Bundesländer betrachtet werden.
Auch hier gibt es eklatante Unterschiede. Oben liegen – wie bei so gut wie allen Erhebungen zum Leistungsstand – Bayern und Sachsen, die durchgängig in allen Fächern signifikant über dem (gesunkenen) Bundesschnitt rangieren. Hinzu gesellt sich erstmals wieder Baden-Württemberg.
Am unteren Ende finden sich Bremen, Hessen und Nordrhein-Westfalen, die konstant unter dem Mittelwert liegen. Das Saarland und Rheinland-Pfalz schneiden in Mathematik und Physik schwächer ab, Niedersachsen zusätzlich auch in Chemie, und Berlin weist eine gewisse Physik-Schwäche auf.
Mutmaßlich positiv erscheinen die Werte von Hamburg – allerdings könnte es hier eine Verzerrung durch eine geringere Teilnehmerquote geben, weswegen die Ergebnisse dort mit Vorsicht zu genießen sind.
Umfeld hat sich gewandelt
Es ist ein allgemeiner Trend sinkender Bildungsqualität, auf den der Migrationshintergrund einen Einfluss hat, der aber durch weitere, teilweise wechselwirkende, Faktoren, eingebettet wird:
- Corona brachte für viele junge Menschen eine Zäsur – mit möglichen Bildungsrückständen und vielleicht erhöhten emotionalen Belastungen. Letztere sind zumindest laut IQB-Erhebung gestiegen und über 50 % der Neuntklässler sieht sich zumindest mit mittleren psychosozialen Auffälligkeiten konfrontiert, die natürlich nicht zwangsläufig durch die Pandemiezeit bedingt sein müssen. Trotzdem ist der Anstieg besorgniserregend.
- Die virtuelle Welt ist heute für viele prägend und übernimmt im gewissen Sinne Erziehungsfunktionen, die eigentlich den Eltern obliegen sollten.
- Anerkennung und Belohnung sind dort durch schnelle Reize und kurzfristige Dopaminausschüttung leicht erreichbar – im realen Leben dagegen mühsam. Warum sich also anstrengen? Es ist wenig überraschend, dass über 60 % der betroffenen Schüler als zumindest mittelmäßig hyperaktiv gelten. Auch dieser Trend ist klar negativ und die Konditionierung der Schüler auf schnelle Reize und Belohnungen werden oft nicht ausreichend berücksichtigt.
- Die Gesellschaft ist heute in viele kleinere Subkulturen mit eigenen Normen und Vorstellungen zerfallen. Diese existieren parallel nebeneinander und haben sich weitgehend entkoppelt. Nicht jede dieser Milieus erkennt in Begriffen wie „Leistung“ oder „Bildung“ überhaupt noch einen Wert und dies wird auch den Kindern und Kindeskindern vermittelt.
- Die Wirklichkeit vieler Menschen hat daher mit dem, was manche als gewünschte Normalität wahrnehmen, längst nichts mehr zu tun. Was als Abweichung erscheint, ist für andere längst Alltag.
- Ökonomischer und persönlicher Niedergang: Eltern, die am System zweifeln, geben diese Haltung weiter. Dies spiegelt sich oft in Wahlergebnissen wider und Schule ist nun einmal Teil der staatlichen Ordnung.
Das sind nur einige Entwicklungen mit stark gesellschaftlichem Fokus. Es ließe sich noch mehr nennen, wie marode Schulen, eine Unterfinanzierung, die Unklarheiten im Umgang mit der Digitalisierung, die qualifizierte Anpassung der Pädagogen an neue Gegebenheiten oder der allgegenwärtige Lehrermangel, doch schon diese Umstände zeigen: Das Umfeld der Bildungseinrichtungen hat sich massiv verändert und ist nicht mehr mit früheren Zeiten vergleichbar. Das stellt die Frage, ob die Schulen überhaupt noch die Erwartungen erfüllen können.
Was tun? Sechs wichtige Ansätze
Was also tun? Die Zahlen sind eindeutig – und als klarer Auftrag zu verstehen:
- Deutsch als Bildungssprache sichern. Sprachzeit ist Lernzeit – gerade für die erste Generation. Wer früh und verbindlich fördert, schließt Leistungslücken.
- Kernfächer priorisieren.
- Leistung ernst nehmen – ohne Ausreden. Migration wirkt, aber der Abwärtstrend wäre auch ohne sie da. Länder wie Sachsen und Bayern zeigen, dass höhere Niveaus erreichbar sind. Trotz struktureller Unterschiede können sie teilweise Vorbild sein.
- Umfeldeinflüsse aus der virtuellen Welt werden massiv unterschätzt. Die Auswirkungen auf Verhalten, Persönlichkeitsentwicklung und Fähigkeiten müssen erforscht und gesteuert werden.
- Soziale Interaktionen und Solidarität sind wichtig und sollten erlebbar gemacht werden.
- Schule ist kein Reparaturbetrieb. Bildung beginnt im Elternhaus, im sozialen Umfeld – und heute auch im Internet. Nur eine gemeinsame Kraftanstrengung kann die Bildung der Zukunft sichern.
Manches davon wurde bereits angegangen, kann sich aber natürlich nicht so schnell auswirken, um Niederschlag zu finden. Als Beispiel sei die PISA-Initiative in Bayern, eine direkte Reaktion auf schwaches Abschneiden in verschiedenen Bildungserhebungen, genannt.
Auch gibt es in manchen Bundesländern (Bayern, Berlin, Hessen) verpflichtende Sprachtests für alle Kinder vor der Einschulung, allerdings nicht im gesamten Bundesgebiet. Unabhängig von der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung mit all ihren mannigfaltigen Einflüssen, gibt es auch noch weitere Hausaufgaben, die auf Erledigung warten.
Fazit: Migration trägt zur Rückgang des Niveaus bei, ist aber nicht alleiniger Grund
Zusammengefasst macht Migration den Schulbetrieb anspruchsvoller. Sie trägt ihren Teil bei und macht zusätzliche Strategien unumgänglich.
Positive Werte der IQB-Erhebung in den Bereichen „soziale Eingebundenheit“ und „Schulzufriedenheit“ deuten darauf hin, dass es an dieser Stelle ausbaufähige Potenziale gibt, die allerdings vielfach noch lange nicht ausgeschöpft sind, aber genutzt werden müssen, damit aus einer großen Herausforderung ein Teil der Lösung für die künftige Gesellschaft und Arbeitswelt werden kann.
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund so groß ist, dass er Zukunft Deutschlands prägen wird
Trotzdem sind die schwächeren Ergebnisse ein allgemeiner Trend. Die reine Konzentration auf ein monokausales Themenfeld verstellt den Blick auf weitere Einflussfaktoren, die es so vor ein bis zwei Dekaden noch nicht gab, während andere an Kraft verlieren.
Die Probleme ausschließlich an die Migration zu knüpfen, löst sie nicht – es macht blind für ebenso wirkmächtige Einflüsse wie die digitale Welt. Aufgeben ist dabei keine Option, denn es darf nicht vergessen werden, dass der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund inzwischen so groß ist, dass er die Zukunft Deutschlands prägen wird.
Sie sind, ob das nun Gefallen finden mag oder nicht, das neue Deutschland. Es bedarf daher einer gesamtgesellschaftlichen Kraftanstrengung, um eine chancengerechte Bildung für alle zu garantieren sowie zu ermöglichen. Auch davon wird die Zukunft des Landes abhängen.
Andreas Herteux ist Wirtschafts- und Sozialforscher, Herausgeber und Autor des Standardwerks zur Geschichte der Freien Wähler (FW) und Gründer der Erich von Werner Gesellschaft. Er ist Teil unseres EXPERTS Circle. Die Inhalte stellen seine persönliche Auffassung auf Basis seiner individuellen Expertise dar.