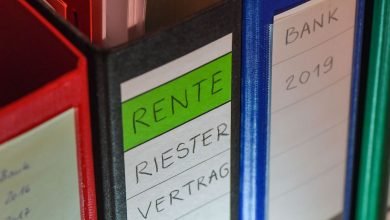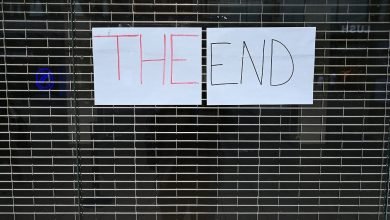Ist Kaffee vollwertig? Oder schädlich? | ABC-Z

Stand: 17.09.2025 11:41 Uhr
| vom
Ob mit Koffein oder entkoffeiniert: Studien zeigen gesunde Effekte von Kaffee auf Darm, Herz, Blutdruck, Entzündungen und weiteres. Menge, Zubereitung und Zeitpunkt des Kaffeekonsums sind entscheidend.
Lange hieß es Kaffee würde “das Herz belasten” oder “den Körper entwässern”. Forschende beobachteten bereits vor vielen Jahrzehnten Menschen, die regelmäßig Kaffee tranken. Zeigten sich gesundheitliche Probleme, wurde der Kaffee als Ursache gesehen. Doch es wurde nicht berücksichtigt, welche anderen Gewohnheiten diese Menschen hatten. Viele Kaffeetrinkende rauchten beispielsweise regelmäßig Zigaretten – eine Tatsache, die früher nicht in die Untersuchungen einbezogen wurde. Heute weiß man: Negative Effekte, die damals dem Kaffee zugeschrieben wurden, stammten eher von der Zigarette als aus der Kaffeetasse.
Was steckt im Kaffee?
Kaffee enthält neben Koffein eine Vielzahl von gesunden Inhaltsstoffen, darunter Mineralstoffe wie Kalium sowie Aromastoffe, die für den Geschmack verantwortlich sind. Wichtig ist der Gehalt an verschiedenen bioaktiven Substanzen wie sekundären Pflanzenstoffen (Polyphenolen), insbesondere Chlorogensäuren, Terpenoide und Alkaloide, die eine starke antioxidative Wirkung haben und vor zellschädigenden freien Radikalen schützen können.
Warum Kaffee entzündungshemmend wirkt
Aufgrund seines hohen Gehalts an antioxidativen Inhaltsstoffen kann Kaffee dazu beitragen, chronische Entzündungen zu reduzieren. Studien haben ergeben, dass Kaffee zum Beispiel die Leberenzyme günstig beeinflusst und die Entwicklung von Leberschäden bremst. Kaffee soll auch das Risiko für chronische Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und verschiedene Krebsarten reduzieren. So konnten chinesische Forschende in einer Studie nachweisen, dass moderater Kaffeekonsum (drei Tassen täglich) das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und Fettleibigkeit senkt. Allerdings ist die Dosis entscheidend: Hoher Kaffeekonsum kann in Ausnahmefällen die Konzentration von Entzündungsmarkern erhöhen, insbesondere bei bestehenden Erkrankungen oder bei empfindlichen Menschen.
Kaffee fördert die Darmgesundheit
Eine Untersuchung von 2024 fand heraus, dass regelmäßiger Kaffeekonsum die Vielfalt und Stabilität des Darmmikrobioms fördert. Kaffeetrinkende weisen eine erhöhte Anzahl nützlicher Bakterienstämme wie Lawsonibacter asachharolyticus, Alistipes und Faecalibacterium auf. Diese Mikroben sollen in einem Zusammenhang stehen mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf- und Lebererkrankungen. Kaffee erhöht zudem die Konzentration von Bifidobacterium, das die Verdauung unterstützt und Infektionen vorbeugen kann. Verantwortlich dafür sind die im Kaffee enthaltenen sekundären Pflanzen- und Ballaststoffe, die die Darmgesundheit positiv beeinflussen.
Kaffee lässt Frauen gesund altern
Die aktuellen Ergebnisse einer Harvard-Studie die über einen Zeitraum von 30 Jahren durchgeführt wurde, legen nahe, dass Frauen, die regelmäßig Kaffee trinken (etwa drei kleine Tassen täglich), mit größerer Wahrscheinlichkeit gesund altern, also körperlich aktiver bleiben und weniger chronische Erkrankungen haben. Der Schutz wird auf die entzündungshemmenden Substanzen wie die Chlorogensäuren im Kaffee zurückgeführt. Zudem soll maßvoller Kaffee-Konsum laut einer amerikanischen Studie von 2009 das Risiko für Schlaganfälle bei Frauen leicht senken.
Entkoffeinierter vs. normaler Kaffee
Entkoffeinierter Kaffee bietet nahezu dieselben gesundheitlichen Vorteile wie koffeinhaltiger Kaffee, da die meisten Antioxidantien erhalten bleiben. Einer Untersuchung von 2014 zufolge senkt entkoffeinierter Kaffee das Risiko für Typ-2-Diabetes, Lebererkrankungen und bestimmte Krebsarten ähnlich wie normaler Kaffee. Für Menschen mit Koffeinempfindlichkeit ist die koffeinfreie Variante geeigneter.
Magenschmerzen, Sodbrennen und Herzrasen nach Kaffeekonsum
Kaffee regt die Säureproduktion im Magen an und kann bei empfindlichen Menschen Sodbrennen oder Reflux verschlimmern. Manche Personen bekommen nach dem Genuss von Kaffee Magenschmerzen, Herzrasen oder Schweißausbrüche. Wasser kann helfen, die Beschwerden zu lindern. Generell gilt: Wer zu diesen Beschwerden neigt, sollte den Kaffeekonsum reduzieren, milderen oder koffeinfreien Kaffee bevorzugen.
Entzieht Kaffee dem Körper Flüssigkeit?
Lange Zeit wurde Kaffee als “Flüssigkeitsräuber” betrachtet. Studien widerlegen das jedoch: Während Koffein eine mild harntreibende Wirkung hat, wird diese durch den Wasseranteil im Kaffee ausgeglichen, sodass Kaffee genauso zur Flüssigkeitszufuhr beiträgt wie Wasser. Regelmäßige Kaffeetrinker entwickeln zudem eine Toleranz gegenüber der harntreibenden Wirkung – und selbst hoher Kaffeekonsum hat keine negativen Auswirkungen auf den Flüssigkeitshaushalt.
So wirkt Koffein
Koffein beschleunigt die Herztätigkeit, den Stoffwechsel und die Atmung, lässt den Blutdruck und die Körpertemperatur leicht ansteigen. Die Blutgefäße erweitern sich und die Durchblutung aller Organe nimmt zu. Das im Kaffee enthaltene Koffein wirkt vor allem im Gehirn. Es ist chemisch so ähnlich aufgebaut wie der Botenstoff Adenosin, der müde macht. Das Koffein blockiert die Andockstellen von Adenosin im Gehirn, daher hat Kaffee eine wachmachende Wirkung und verbessert die Konzentrationsfähigkeit. Diese Wirkung hält im Durchschnitt vier Stunden an. Aufgrund von genetischen Varianten des Adenosin-Rezeptors führt Kaffeekonsum am Nachmittag bei einigen Menschen zu Einschlafstörungen. Und auch wer es nicht merkt: Nach spätem Koffeinkonsum ist die Schlafqualität meistens schlechter als ohne.
Wie viel Koffein ist gesund?
400 Milligramm Koffein am Tag sind laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Heimat (BMLEH) und der Europäischen Agentur für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in der Regel kein Problem. Das entspricht:
- 4,5 Tassen Filterkaffee à 200 ml: je 90mg
- 6 Espressi: je 63 mg pro Espresso
- 5 kleinen Dosen Energy (à 250 ml): je 80 mg
- 8 Tassen schwarzer Tee (à 200 ml): je 45 mg
- 11 Dosen Cola (à 330 ml): je 35 mg
Ist Kaffee in der Schwangerschaft gesund?
Für Schwangere gilt ein maximaler Koffeinkonsum von 200 Milligramm pro Tag als unbedenklich – das entspricht etwa zwei Tassen Filterkaffee. Besser ist jedoch entkoffeinierter Kaffee, da das Koffein die Plazenta passiert und beim Kind zu Schlafproblemen und Wachstumsverzögerungen führen kann, da Babys Koffein nur langsam abbauen. Laut einer Studie kann Koffein zu einem geringeren Geburtsgewicht des Kindes führen. In einer weiteren Studie werden Fehlgeburten mit Koffeinkonsum in der Schwangerschaft in einen Zusammenhang gebracht.
Kaffee erhöht den Blutdruck nur kurzzeitig
Nach dem Konsum von Kaffee kann es zu einem vorübergehenden Anstieg des systolischen und diastolischen Blutdrucks um etwa 10 bis 20 mmHg kommen. Regelmäßiger Kaffeekonsum führt jedoch zu einer Gewöhnung: Innerhalb von ein bis zwei Wochen nimmt die blutdrucksteigernde Wirkung ab oder verschwindet vollständig. Das erklärt, warum Menschen, die nur gelegentlich Kaffee trinken, stärkere Blutdruckschwankungen erfahren als Personen, die viel Kaffee konsumieren. Die Annahme, dass moderater Kaffeekonsum das Risiko für die Entwicklung von Bluthochdruck (arterielle Hypertonie) erhöht oder bei bereits bestehenden Beschwerden zu einer Verschlechterung führt, wird durch eine große Metastudie widerlegt: Die Untersuchung zeigt, dass moderater Kaffeekonsum insgesamt nicht mit einem erhöhten Risiko für Bluthochdruck verbunden ist.
Herzschutz durch Kaffee?
Der regelmäßige Kaffeekonsum geht einer englischen Studie von 2022 zufolge mit einem geringeren Risiko für Herzinsuffizienz, Schlaganfall und Herzinfarkt einher. Die antioxidativen Inhaltsstoffe könnten eine Schutzwirkung entfalten und Mikroentzündungen hemmen, die als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten. Aber wieder gilt: Die Dosis ist entscheidend. Übermäßiger Konsum kann das Herz belasten. In einer Hamburger Untersuchung von 2023 fand sich kein Zusammenhang von Kaffeekonsum und Herzgesundheit – also weder ein schädlicher noch ein nützlicher Einfluss.
Kaffee bei Herzrhythmusstörungen
Neue Studien geben Entwarnung: Bei gesunden Menschen führt Kaffeekonsum nicht zu vermehrten Herzrhythmusstörungen. Es konnte kein Zusammenhang zwischen Kaffee und dem Auftreten von Arrhythmien nachgewiesen werden. Menschen mit bestehenden Herzrhythmusstörungen sollten dennoch ärztlichen Rat einholen, da die Empfindlichkeit auf Koffein unterschiedlich sein kann.
Kaffee – gut fürs Gehirn
Kaffee kann verschiedene positive Effekte auf das Gehirn haben. Eine wissenschaftliche Untersuchung im Rahmen der großen Women´s Health Studie ergab, dass Kaffee das Risiko für Demenzerkrankungen senken kann. Schon mehrfach wurde über geringe schützende Effekte vor Parkinsonerkrankungen berichtet. Laut einer niederländischen Studie hilft Kaffee auch, die neurologischen Parkinson-Symptome zu lindern. Außerdem soll Kaffee das Risiko für Depressionen senken, wie eine spanische Studie zeigt. Eine aktuelle Untersuchung aus Bielefeld legt nahe, dass Kaffee nicht nur wach, sondern auch glücklich machen kann.
Koffein beeinflusst Medikamente
Mäßiger Kaffeekonsum kann Kopfschmerzen lindern. Darüber hinaus kann Koffein die Wirkung von Schmerzmitteln wie Acetylsalicylsäure (Aspirin), Ibuprofen oder Paracetamol verstärken. Darum werden viele Schmerzmittel gezielt mit Koffein kombiniert. Schmerzmediziner warnen allerdings, dass diese Kombination das Risiko für schädlichen Übergebrauch und schmerzmittelinduzierten Kopfschmerz erhöht. Wichtig zu wissen: Koffein beeinflusst auch die Wirkung anderer Medikamente wie Blutdrucksenker, Antidepressiva, Magensäurehemmer oder Schilddrüsentabletten. Dabei können die Wirkungen sowohl abgeschwächt als auch verstärkt werden. Generell gilt: Tabletten und Tropfen sollten immer nur mit Wasser eingenommen werden. Um Wechselwirkungen mit Kaffee zu vermeiden, empfiehlt sich ein Zeitabstand von zwei Stunden zwischen der Einnahme der Medikamente und dem Kaffeekonsum.
Filter, French Press und Co – welcher Kaffee ist gesünder?
Die Art der Kaffeezubereitung hat nur geringen Einfluss auf den gesundheitlichen Wert. Filterkaffee schneidet laut einer Veröffentlichung aus 2020 im New England Journal of Medicine am besten ab. Das Papier filtert Diterpene wie Cafestol und Kahweol, heraus, die das LDL-Cholesterin (“schlechtes” Cholesterin) ansteigen lassen. In einer schwedischen Studie ließen Espresso (drei bis fünf Tassen täglich) und per French Press zubereiteter Kaffee (weniger als sechs Tassen täglich) den Cholesterinspiegel ansteigen – bei Filterkaffee erst nach mehr als sechs Tassen täglich. Löslicher Kaffee (Instantkaffee) zeigte diesen Cholesterin-Effekt nicht. Wahrscheinlich spielt auch die Kontaktzeit von Wasser und Kaffeepulver eine Rolle: Bei Espresso, Kapselkaffee oder Kaffeepads ist die Zeit, in der die Diterpene in den Kaffee gelangen können, kürzer als bei Frenchpress oder wenn das Kaffeepulver direkt in die Tasse gegeben wird. Allerdings ist fraglich, ob der Einfluss allein eines Lebensmittels auf die Blutfettwerte insgesamt klinisch relevant ist. Bis zu drei Tassen Kaffee werden auch bei Fettstoffwechselstörungen empfohlen.
Nachteile von zu viel Kaffee
Kaffee ist also weder ausschließlich gesund noch ungesund. Moderater Kaffeegenuss hat viele gesundheitliche Vorteile, während übermäßiger Konsum negative Folgen haben kann. Zu viel Kaffee kann zu Schlafstörungen, Unruhe, Herzrasen sowie zu Kopfschmerzen nach plötzlichem Absetzen führen – bei empfindlichen Menschen auch schon bei niedrigem Konsum. Bei Überkonsum können Angstzustände, Nervosität und Abhängigkeit entstehen.