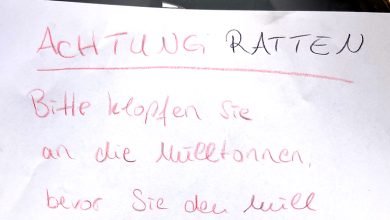Inklusion in Berlin: Kein Geld für Selbstbestimmung | ABC-Z

Dort zeigt sie ihren 46.000 Followern, wie sie allein ihre Wäsche wäscht, ihre Katzen versorgt oder puzzelt. Sie hat auch eine Videoreihe gedreht, die über den Job und Alltag einer persönlichen Assistenz aufklärt, darunter eines mit dem Titel: „Nerven mich eigentlich meine Assistenzen?“ Spoiler: Ja. „Aber nicht, weil sie sie sind“, sondern weil Bade lieber nicht dauernd Menschen um sich hätte, deren Unterstützung sie aber blöderweise dauernd benötigt.
Wenn Bade also so viel darüber redet, dann – so die naheliegende Schlussfolgerung – ist Inklusion wohl eher nicht vorhanden. Zumindest nicht auf Instagram. Und auch nicht in Berlin, wo Bade vor 25 Jahren mit Spastik geboren wurde und heute in einer Dreizimmerwohnung in Marienfelde lebt.
Dort sitzt Linn Bade am Schreibtisch. Die dunkelbraunen Haare trägt sie kurz, das Kleid beige, die Fingernägel türkis lackiert. „Momentan bin ich wieder im Excel-Fieber“, sagt sie und scrollt mit Hilfe eines Joysticks durch ein paar Tabellen, Schichtpläne und Abrechnungen. Nicht so schlimm, sagt die ausgebildete Mediengestalterin, schließlich verbringe sie sowieso die meiste Zeit des Tages vor ihrem Computer. „Und Programmieren macht mir auch Spaß.“
Weniger Geld für gleiche Arbeit
Gerade unterstützen zehn Persönliche Assistenzen Bade rund um die Uhr, 850 Stunden pro Monat, alle direkt bei ihr angestellt. Eine davon: Hélène, eine ehemalige Grundschullehrerin aus Frankreich, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will. Sie hat gerade ihren ersten Tag mit Bade und wird sie später noch ins Fitnessstudio begleiten. Dort wird sie ihr helfen, die Geräte einzustellen. Und auch sonst unterstützt sie Bade bei allem, was mit Feinmotorik zu tun hat: essen, saugen, Zähne putzen. Dass Bade entscheiden kann, wer ihr im Alltag hilft, diese Selbstbestimmung ist für sie eine „politische Errungenschaft“.
In den vergangenen Monaten ist es allerdings immer schwieriger geworden, persönliche Assistenzen zu finden – noch dazu eine, mit der es auch passt. Für Bade sonnenklar, woran das liegt: „Die ambulanten Dienste bekommen den Tarifvertrag vom Senat weiterhin vollumfänglich finanziert, die Assistenzen im Arbeitgeber*innenmodell aber nicht.“
Im Arbeitgeber*innenmodell verdient man bei gleicher Arbeit bis zu 340 Euro weniger im Monat
Konkret heißt das: Wer in Berlin bei einem ambulanten Dienst angestellt ist, wird weiterhin nach Entgeltgruppe 5 bezahlt, bekommt also je nach Erfahrung und Beschäftigungsdauer zwischen 3.039 und 3.680 Euro im Monat. Wer allerdings im Arbeitgeber*innenmodell beschäftigt ist, verdient bei gleicher Arbeit bis zu 340 Euro weniger im Monat – und das seit Februar 2025. Wer wechselt da nicht lieber zum Dienst? Oder denkt zumindest darüber nach?
Refinanzierung nicht verlängert
Vor sechs Jahren schlossen die Dienste mit dem Senat einen Tarifvertrag – eigentlich eine Errungenschaft, die aber das Arbeitgeber*innenmodell finanziell abwertete. Viele persönliche Assistenzen wechselten zu den Diensten. Als Konsequenz gründeten einige behinderte Arbeitgeber*innen, darunter auch Bade, den Verein „Arbeitsgemeinschaft der behinderten Arbeitgeber*innen mit Persönlicher Assistenz e. V.“, kurz AAPA.
Über ein halbes Jahr hinweg erarbeiteten sie einen eigenen Tarifvertrag, der 2021 und 2023 für zwei Jahre verlängert wurde. CDU und SPD versprachen 2023 im Koalitionsvertrag, die Refinanzierung weiterhin sicherzustellen. Aber: Die Refinanzierung läuft Ende des Jahres aus und der Senat will sie nicht verlängern.
Unter den Assistenzen im Arbeitgeber*innenmodell herrscht viel Frust – so auch bei Jan Gehling und Hannah Bär, die seit vielen Jahren in dem Beruf in Berlin arbeiten. Seit 2019 sind sie zudem Mitglieder der Tarifkommission bei Verdi. „Wir versuchen, jeden Strohhalm zu greifen, gehen zu Veranstaltungen, demonstrieren, lassen uns beim Arbeitnehmerempfang blicken“, sagt Bär seufzend.
Dort habe sie Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) getroffen, die ihr versicherte, sie sei im Prinzip für die Refinanzierung, sehe aber die Entscheidungsgewalt bei der Senatsverwaltung für Finanzen. Die wiederum sehe diese bei der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung. „Eine Frechheit, sich da so rauszuwinden“, findet Bär.
Wechsel zu Assistenzdiensten wäre teuer
Auf taz-Nachfrage heißt es aus dem Hause Kiziltepes, man handle dem Sozialrecht entsprechend, also nicht illegal. Und: „Wir wissen, dass es dringend ist.“ Man stehe aktuell „im engen Austausch mit der Senatsfinanzverwaltung“ und habe die Thematik an ein Gremium übergeben, „um zu wirtschaftlichen Lösungen zu gelangen“.
Dabei ist nicht nur die Refinanzierung ein Kostenpunkt für den Senat, sondern auch die aktuelle Situation. Denn: „Wir verwalten ja alles selbst“, so Bade, die mittlerweile im Wohnzimmer sitzt. Mit dem AAPA e. V. hat Bade ausgerechnet: Würden alle Arbeitgeber*innen von heute auf morgen zu den eh schon überlasteten Diensten wechseln, würde das den Staat über zwölf Millionen Euro mehr kosten – nur für die Verwaltung.
Bade wollte aber nicht nur rechnen, sondern auch aktiv werden. „Da musste irgendwas Nerviges her. Irgendwas, das man nicht ignorieren kann – wie eine Mahnwache“, erzählt Bade, während ihre Katze Lucky um ihre Beine streicht. Eine zweite Katze – Flecki – springt auf die Couch hinter ihr, Hélène füllt das Wasserglas auf und Bade fährt fort: Innerhalb einer Woche habe sie eine Mahnwache organisiert, die vom 22. April bis 28. Mai dauerte. Sechs Wochen also, in denen sich jeden Tag von 11 bis 16 Uhr um die 20 Vereinsmitglieder und Assistent*innen für die Refinanzierung des Tarifvertrages versammelten. Bade erstellte dafür extra einen Schichtplan – natürlich mit Excel –, der pro Tag zwei Gruppen für bis zu drei Stunden vorsah.
Mit Schildern in den Händen und an den Rollstühlen protestierten die Arbeitgeber*innen und ihre Assistent*innen vor der Senatsverwaltung für Arbeit. Selbstbestimmung in Gefahr!“ stand zum Beispiel darauf. Auf dem Boden breiteten sie immer wieder ein großes, grellgrünes Banner aus: „Persönliche Assistenzen stärken: Tarifverträge sind zu refinanzieren!“ In der Ecke unten links ein großes rotes Herz mit dem Schriftzug Verdi – ein Zeichen, dass die Gewerkschaft hinter ihnen steht.
Ab kommenden Jahr noch weniger Geld
Das bestätigt auch Tarifkommissionsmitglied Gehling: „Eigentlich ist das Arbeitgeber*innenmodell die aktuell weiteste Form der Emanzipation. Ich persönlich halte den AAPA für die Speerspitze der Behindertenbewegung in Berlin, in Deutschland und auch in einem großen Teil der Welt.“
Sabrina Ingerl, seit fünf Jahren persönliche Assistentin im Arbeitgeber*innenmodell, ist durch die Mahnwache auf den Arbeitskampf und die Tarifkommission aufmerksam geworden. Die „Ignoranzhaltung des Senats“ mache sie fassungslos. „Wir sind nicht viele Leute. Wir können nicht streiken und wir haben kein Druckmittel.“ Das Dilemma, das viele Angestellte im sozialen Bereich kennen: Würden die persönlichen Assistenzen streiken, ließen sie die Menschen mit Behinderung allein. Auch Bade sieht das so: „Das ist perfide: Wir sind komplett ausgeliefert.“
Deshalb sei der Zusammenhalt unter den Protestierenden umso wichtiger. „Eigentlich ist das ja verrückt“, überlegt Bade. „Wo gibt es das denn, dass Arbeitgeber*innen für höhere Löhne kämpfen? Normalerweise wollen die ja nicht mehr bezahlen und die Arbeitnehmer*innen protestieren.“
Nach sechs Wochen – „Wir konnten nicht mehr“ – endete die Mahnwache mit einem Teilerfolg. Sozialsenatorin Kiziltepe und der Senat sprechen jetzt auch von den zwölf Millionen Euro Mehrkosten. Ob das den schwarz-roten Senat dazu bewegt, den Tarifvertrag doch zu refinanzieren, bleibt abzuwarten. Klar ist: Ab Januar 2026 sollen die persönlichen Assistenzen im Arbeitgeber*innenmodell nicht mehr nach Entgeltstufe 5, sondern nur noch nach Entgeltstufe 3 bezahlt werden. Und damit langfristig noch weniger Geld für die gleiche Arbeit verdienen.