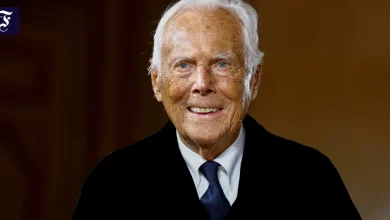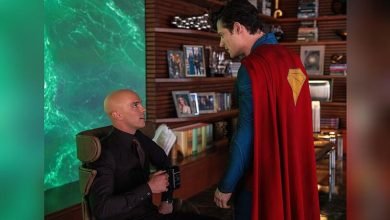Karsten Krampitz’ Roman über Behindertenkommune von Hartroda | ABC-Z

Nächste Woche erscheint ein DDR-Roman, der aus so ziemlich allen Rastern des Genres herausfällt. Es geht zwar um Freiheit, Stasi, Schießbefehl und Kirchenopposition, aber in einer Gemengelage, die völlig quer zu den gewohnten Erzählungen darüber steht. Die Freiheit wird hier nämlich durch eine Kommune von Schwerstbehinderten repräsentiert, die es Anfang der Achtzigerjahre in dem thüringischen Dorf Hartroda wirklich gegeben hatte, inspiriert von dem 2020 verstorbenen Matthias Vernaldi, der sich wegen seiner progressiven Muskeldystrophie in seinem Rollstuhl nicht bewegen konnte, aber mit seinem theologisch und dialektisch geschulten Kopf einen Anziehungspunkt für Hippies und Freigeister aus der ganzen DDR schuf.
Der Berliner Autor Karsten Krampitz kannte Vernaldi und hat in den Zweitausendern auch bei dessen Zeitschrift „Mondkalb – Zeitung für das organisierte Gebrechen“ mitgewirkt. Sein Roman „Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung“ verbindet den Stoff nun mit der erfundenen Geschichte eines ehemaligen Grenzers, der in der Kommune der zuverlässigste Pfleger ist; diesen schweigsamen Mann, Bernd Mozek, treibt eine ungeklärte, erst am Ende des Buchs vollends aufgedeckte Schuld um.
Erst mal steht aber das Unglaubliche der Kommune selbst im Vordergrund, wie da inmitten der DDR, in den nicht vollends definierten Zwischenräumen der Staats- und Kirchenbürokratie, ein paar junge Behinderte ihr Pflegeheim verlassen und sich mit ihren Renten und Pflegegeldern in einem verlassenen Pfarrhaus ihr eigenes Leben organisieren. Sie hatten keine Lust, heißt es, ihre „letzten Jahre voller Sehnsucht den Stationsflur runterzuschauen: umsorgt, entsorgt und entmündigt. War das alles, das Dasein? Oder käme vielleicht noch ein Leben? Die Zeit war knapp.“

Was dem Roman mit seiner schnoddrigen, unsentimentalen und dabei erstaunlicherweise doch feinfühligen Sprache gelingt, ist, die historisch verbürgte Aktion zu einer ganz gegenwärtigen Parabel auf die Möglichkeit eines auch unter widrigsten Umständen freien Lebens zu machen. Die Hauptperson ist dabei Gruns, der ohne Hilfe noch nicht einmal seine Notdurft verrichten kann, was in aller Konkretheit beschrieben wird. Dieser Gruns, dem die Ärzte prophezeiten, dass er die Pubertät wahrscheinlich nicht überleben werde, schafft es, bei der Predigerschule in Eisenach ein Fernstudium abzuschließen; seither erklärt er die Zusammenkünfte in Hartroda auf seine unorthodoxe Art zu Gottesdiensten (was auch den Vorteil hat, dass sie dadurch bei den Behörden nicht angemeldet werden müssen). Die spezielle Mischung aus sozialistischen, libertären und christlichen Ideen in seinen Ansprachen zieht immer mehr und vor allem junge Menschen an. Auch eine Bluesrockband namens Mischpoke nistet sich ein und liefert den Soundtrack dieser „wunderbaren Jahre“. Einmal gelingt Gruns sogar das Kunststück, seine Predigt mit dem sowjetkommunistischen Klassiker „Wie der Stahl gehärtet wurde“ unangreifbar zu machen und dabei die kollektivistische Befreiung der Menschheit umstandslos in die doch ganz anders geartete Frohe Botschaft münden zu lassen.
Jedem nach seinen Bedürfnissen
Auf vergleichbare Weise glückt es dem respektlos-humoristischen Ton des Romans, das eigenartige Pathos dieser Mühseligen und Beladenen im real existierenden Sozialismus ernst zu nehmen, ohne dass es in Kitsch abgleitet. Davor bewahrt es auch die illusionslose ökonomische Verortung der Gemeinschaft. Im Lauf der Zeit lässt diese sich von westdeutschen Geldern finanzieren, die durch ostdeutsche Kirchenleute diskret und steuerfrei übergeben werden. Die Dialektik des Geschehens wird dabei immer wieder mit selbstironisch vollmundigen Sentenzen kommentiert. In Hartroda sei eben der Kommunismus Wirklichkeit geworden: jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen.
Je mehr sich die Geschichte jedoch auf den Mauerfall zubewegt, der das Ende der Kommune bedeutet, desto mehr wird sie zu einer Burleske, die ein wenig den roten Faden verliert. Die anspielungsreichen Pointen für DDR-Connaisseure drohen sich da zu verselbstständigen, etwa wenn der Totalverriss der Mischpoke-Band in den Westpopmedien breit ausgewalzt wird, und auch Gruns’ Entdeckung der Westberliner Bordelle kommt etwas vom Haupthandlungsstrang ab. Mit der Wende verliert Hartroda seine „Geschäftsgrundlage“: Dafür, dass sie den Behinderten ein Leben jenseits des Heims ermöglichten, hatten die angestellten Pfleger, die im Roman durchgängig „Latscher“ heißen, Schutz vor dem Staat erhalten. Das ist jetzt hinfällig geworden, und dann beschädigen auch noch diverse Stasi-Enthüllungen Gruns’ Grundvertrauen in die Menschen seiner Umgebung. Erst als die Wahrheit über den schweigsamen Mozek offenbar wird, kommt die Tragikomödie wieder zu sich selbst. Nur so viel sei dazu verraten: Der rote Faden ist am Ende wieder da, und es gibt sogar Hoffnung, dass das Ganze gegen alle Wahrscheinlichkeit doch weitergeht.