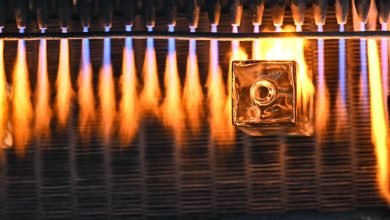Social Freezing: Warum Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen | ABC-Z

Die biologische Uhr anhalten. Und der Chef bezahlt die Rechnung. Was nach techno-utopischer Phantasie klingt, ist längst Realität in großen Unternehmen wie Apple oder Facebook. Schon im Jahr 2014 warben sie damit, die Kosten für das Einfrieren der Eizellen von Mitarbeiterinnen zu übernehmen. Frauen sollten die Chance bekommen, Karriere und Familienplanung zu versöhnen – so lautete das verheißungsvolle Versprechen. Mit bis zu 20.000 US-Dollar beteiligten sich schon damals die beiden Unternehmen an den Kosten für die verzögerte Familienplanung.
Das Angebot kam zu einer Zeit, in der amerikanische IT-Firmen unter Druck standen, sich für den geringen Frauenanteil in den eigenen Reihen zu rechtfertigen. Im Wettkampf um die qualifiziertesten Mitarbeiter boten die Unternehmen weitere familienfreundliche Leistungen an: Facebook etwa beteiligte sich an den Kosten für Kinderbetreuung und Adoption; Apple warb mit einem langen, bezahlten Mutterschaftsurlaub. Man wolle Frauen bei Apple ermöglichen, die beste Arbeit ihres Lebens zu leisten, während sie sich um ihre Familien kümmerten, lautete die Verheißung. Mittlerweile sind die sogenannten Fertility Benefits fester Bestandteil der amerikanischen Unternehmenskultur – die US-Millennials sind die erste Generation, die auf Firmenkosten ihren Kinderwunsch aufschieben können. Endstation Kapitalismus oder der Weg zu mehr reproduktiver Selbstbestimmung?
Das Verfahren gibt es schon seit den Achtzigerjahren
Kaum war 2014 der Silicon-Valley-Traum verkündet, wurden in Deutschland die Eizellen von Frauen zum Ort ethischer und gesellschaftspolitischer Debatten. Die Kontroverse um das sogenannte Social Freezing hatte begonnen. Der Begriff, ein Oxymoron, versucht er doch, das menschliche Zusammenleben mit etwas Technischem, Erstarrtem zu verbinden. Social Freezing ist eine deutsche Wortschöpfung, abgeleitet vom englischen „social egg freezing“. Gemeint ist, dass Frauen ihre Eizellen nicht aus medizinischen Gründen einfrieren lassen – sondern weil sie noch nicht den passenden Partner gefunden haben oder weil sie aus beruflichen oder finanziellen Gründen ihren Kinderwunsch verschieben wollen. Das Verfahren gibt es schon seit den Achtzigerjahren. Es wurde jahrzehntelang bei Krebspatientinnen vor einer Chemotherapie angewendet, die ihre Fruchtbarkeit beeinträchtigen konnte.
Dass Apple und Facebook Social Freezing nun als Zusatzleistungen für ihre Mitarbeiterinnen anboten, feierten die Befürworter in Deutschland als glorreichen Akt der Emanzipation. „Die Befreiung der Frau kommt aus dem Labor“, schrieb der damalige „Spiegel“-Kolumnist Jan Fleischhauer. Das medizinische Verfahren könne den Frauen eher zu Gleichberechtigung verhelfen als endlose Debatten über Gender-Quoten oder Gehaltsunterschiede. Lauter hallten die kritischen Stimmen: Die Schriftstellerin Tanja Dückers bezeichnete die sogenannten Fertility Benefits als „frauen- und mütterverachtend“ und forderte stattdessen bessere Arbeitsbedingungen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Als „völlig daneben“ beschrieb die damalige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig den Plan von Apple und Facebook. Marcus Weinberg, familienpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sprach gar von einem „unmoralischen Angebot“.
Social Freezing ist teuer
Viele meinten, die Firmen würden mit solchen Programmen vor allem ihre eigenen Interessen verfolgen – nämlich die maximale Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiterinnen. Social Freezing sei das Resultat kapitalistischer Verwertungslogik, empörten sich Kritiker. Wieder andere glaubten, dass das, was da im Silicon Valley passierte, auch bald in deutschen Unternehmen gang und gäbe sein werde. So prognostizierte der Leipziger Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky sogar schon 2013: „Im Jahr 2025 wird Social Freezing ein normales Instrument der Familienplanung sein.“ Jetzt haben wir 2025 und wo stehen wir?
Ginge heute eine Dreißigjährige zu ihrer Personalabteilung, um die Kosten für die Kryokonservierung ihrer Eizellen – so lautet der Fachbegriff – einzureichen, würde sie in den meisten Fällen vermutlich nur ein müdes Lächeln ernten. Das Verfahren ist teuer und trifft auf einen Markt, der ohnehin verspricht, aufzuhalten, was bisher nicht aufzuhalten war: die Alterung des Körpers.
Die Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht
Beim Social Freezing geht es auch um Klassismus. Privilegierte können es sich leisten, ihre biologische Uhr zu verlangsamen. Etwa 4000 Euro kostet der Behandlungszyklus in Deutschland, oft sind zwei bis drei Zyklen notwendig, um eine ausreichende Anzahl an Eizellen zu gewinnen. Die jährliche Lagerung muss ebenfalls bezahlt werden. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht. Auch die In-vitro-Fertilisation wird nur zur Hälfte von den Kassen bezuschusst – und das auch nur, wenn die Paare verheiratet und heterosexuell sind.
In den USA gehört es dagegen in vielen Unternehmen – besonders in der Techbranche – inzwischen zum Standard, dass die betriebliche Gesundheitsvorsorge auch Kinderwunschbehandlungen einschließt. Etwa 40 Prozent aller US-Unternehmen bieten mittlerweile Fertility Benefits an. In Deutschland handelt es sich um ein Randphänomen. Der Pharma- und Chemiekonzern Merck war 2023 das erste deutsche Dax-Unternehmen, das anbot, die Kosten für Social Freezing und andere Kinderwunschbehandlungen zu übernehmen. Das Angebot gilt für alle Mitarbeiter, auch für Männer. Zuvor hatte die Unternehmensberatung Kearney verkündet, ihre Mitarbeiter bei Fertilitätsbehandlungen und Adoption mit bis zu 40.000 Euro zu unterstützen.
Die medizinischen Möglichkeiten erhöhen unsere Freiheitsgrade
Die Firmen nähmen zur Kenntnis, dass sich die jungen Mitarbeiter mitten in der Familienplanung befänden, und unterstützten sie dabei, gute Entscheidungen zu treffen. So sieht es die ehemalige Vizevorsitzende des Deutschen Ethikrates, Claudia Wiesemann. „Es ist positiv, dass sich Firmen für die Familiengründung ihrer Mitarbeiter interessieren“, sagt sie. Ein ethisches Problem gebe es dann, wenn die Firmenangebote nur für Frauen gälten und ausschließlich darauf abzielten, die Fortpflanzung zu vertagen. Laut der Medizinethikerin könnte das als impliziter Zwang verstanden werden, Schwangerschaften hinauszuzögern – und am Ende womöglich kinderlos zu bleiben. Doch sei das in der Regel nicht der Fall gewesen. Damals bei Apple und Facebook nicht und auch heute nicht. Stattdessen sei Social Freezing immer Teil eines großzügigen Gesamtpaketes reproduktionsmedizinischer Maßnahmen gewesen.
Die Möglichkeiten, die uns die Medizin bietet, erhöhen unsere Freiheitsgrade. Aber damit verbunden ist immer auch eine Nötigung zur Entscheidung“, sagt Wiesemann. Es liege an den Individuen, zu prüfen, ob und inwieweit sie diese Freiheiten nutzen wollten oder nicht. „Wenn es um die Fortpflanzungsentscheidungen von Frauen geht – und das finde ich immer verwunderlich –, fühlt sich die gesamte Gesellschaft aufgerufen, da mitzureden.“ Als ob man es, so Wiesemann, Frauen nicht zutrauen würde, in diesem Bereich selbstbestimmte Entscheidungen zu fällen. Entweder werde die Frau zum Opfer erklärt, das sich den Avancen eines Arbeitgebers nicht erwehren könnte – oder das Zerrbild einer Person gezeichnet, die ihrer Karriere alles unterordnet. Die Medizinethikerin fragt: Warum haben so viele Menschen eine klare Vorstellung davon, was in diesem Fall richtig oder falsch sei? „Es sind Frauen, die haben jetzt ihren Kinderwunsch, und sie suchen verzweifelt nach Wegen, sich diese Chance zumindest zu erhalten, auch wenn sie diese jetzt nicht realisieren können.“
„Es betrifft eben nicht nur die ‚kinderlose Jungfer‘“
Familienplanung sehe nun mal nicht mehr so aus wie zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, sagt Wiesemann. Viele Paare hätten einen unerfüllten Kinderwunsch. „Es betrifft eben nicht nur die ‚kinderlose Jungfer‘, wie immer so abschätzig behauptet wird. Sondern es kann jeden von uns betreffen.“ Die Fortpflanzungsmedizin könne diesen Paaren nun ein Angebot machen. Dass die Firmen darauf reagierten, hält die Medizinerin schlicht für gesellschaftlichen Realismus.
Tatsächlich hat die Anzahl der Kinderwunschbehandlungen in Deutschland stark zugenommen. Im Jahr 2023 wurden 130.000 Behandlungszyklen durchgeführt, ein Anstieg um 61 Prozent im Vergleich zu 80.467 im Jahr 2012. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist etwa einer von sechs Menschen weltweit im Laufe seines Lebens von Unfruchtbarkeit betroffen – Männer wie Frauen.
Die Unternehmerin Julia Reichert glaubt deshalb, dass es in der Arbeitswelt eine stärkere Fokussierung auf Familie und Kinder brauche. Reichert ist Ko-Gründerin des Heidelberger Unternehmens Onuava. Sie berät Arbeitgeber, die Fertility Benefits – darunter auch die finanzielle Unterstützung von Social Freezing – anbieten wollen. Im September brachte ihr Unternehmen die erste betriebliche Krankenversicherung für Kinderwunsch in Europa auf den Markt. „Wir denken in Deutschland oft: Das ist nicht Aufgabe des Arbeitgebers, sondern das müssten doch eigentlich die Krankenkassen übernehmen. Tun sie aber nicht beziehungsweise nur sehr eingeschränkt“, sagt sie. Reichert wolle nicht, dass der Kinderwunsch am Geldbeutel scheitere. „Studien zeigen: Mehr als 80 Prozent der Frauen, die sich die Eizellen einfrieren lassen, tun das nicht aus Karrieregründen, sondern weil sie keinen passenden Partner gefunden haben“, sagt Reichert.
„Die Unternehmen machen das nicht aus Selbstlosigkeit“
Die Mitarbeiterinnen würden sich in einem Alter befinden, in dem sie sich die Behandlungskosten allein oft nicht leisten könnten. Würden die Unternehmen Social Freezing und Kinderwunschbehandlungen bezuschussen, machte das eventuell den Unterschied aus, ob die Frauen überhaupt Kinder bekämen. Oder ob sie ein zweites Kind bekommen könnten. „Es ist ein Recruitingelement. Die Unternehmen machen das natürlich nicht aus Selbstlosigkeit, sondern dahinter steht ein ökonomisches Kalkül“, sagt sie und verweist auf Studien aus Großbritannien und den USA. Die zeigten, dass Fertility Benefits ein Grund seien, warum junge Frauen den Arbeitgeber wechselten.
Auch Reichert empfiehlt: Die Angebote sollten immer Fruchtbarkeitstests, Hormonbehandlungen, In-vitro-Fertilisation und andere Leistungen einschließen. Mit nichts könne sich ein Unternehmen familienfreundlicher präsentieren, als damit, den Kinderwunsch zu unterstützen. „Ob die Kinderwunschbehandlungen finanziert werden oder nicht, macht auch einen Unterschied für unsere Geburtenrate aus“, sagt Reichert und verweist auf Dänemark. Dort werden etwa Kinderwunschbehandlungen größtenteils vom Staat getragen, inklusive IVF, Samenspende und Eizellspende – unabhängig vom Familienstand oder sexueller Orientierung. Schätzungen zufolge sind in Dänemark etwa acht bis zehn Prozent aller geborenen Kinder aus einer Kinderwunschbehandlung hervorgegangen. „Man kann sich einfach ausrechnen, was das für Auswirkungen auf die Geburtenrate hat“, sagt Reichert. Natürlich wäre es besser, wenn der Staat dafür aufkäme. Doch solange das nicht passiere, könnten Unternehmen diese Lücke schließen.
„Die Frage der Reproduktion wird auf Frauen abgewälzt“
Der Soziologe Thomas Lemke hält diese Entwicklung gesellschaftlich für den falschen Weg. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Kryotechnologien, zu denen auch das Social Freezing zählt. Was diese Technologien eine, so Lemke, sei ein Strecken von Zeitlichkeit. Damit verbunden: die Antizipation von Zukünften und – im Nachdenken über Social Freezing – eine antizipierte Unfruchtbarkeit. „Die Frage ist, was tue ich in der Gegenwart, um auf diese antizipierte Unfruchtbarkeit in der Zukunft zu reagieren?“, so Lemke. Social Freezing könnte hier zwar eine Lösungsstrategie bieten.
Doch anstatt soziale oder unternehmensbasierte Lösungen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen, werde die Aufgabe an die einzelnen Mitarbeiterinnen outgesourct. Während es eine gesellschaftliche Strategie sei, etwa die Kinderbetreuung zu verbessern, gehe es beim Social Freezing um eine technologische Lösung, die sich auf das Individuum – und damit vor allem auf Frauen fokussiere. „Die Erwartungen sind sehr einseitig und die Lasten ungleich verteilt. Die Frage der Reproduktion wird dabei auf Frauen abgewälzt. Es ist aber eine gesellschaftliche Frage – und die betrifft nicht nur ein Geschlecht“, sagt Lemke.
Medikalisierung des weiblichen Körpers
Jede neue technologische Möglichkeit erfordere es, sich mit ihr auseinanderzusetzen, sobald sie in der Welt sei. Und wenn man sie nicht nutze, werde man womöglich mit der Frage konfrontiert: Warum hast du denn nicht? „Das allein schafft schon Fakten“, sagt der Soziologe. Er spricht von einer Medikalisierung des weiblichen Körpers. „In dem Maße, wie Social Freezing zu einer Option wird, werden alle Frauen, die gebärfähig sind, zu Protopatientinnen.“ Sie müssten sich fragen: Wie ist es um die Qualität meiner Eizellen bestellt? Wann lasse ich sie einfrieren und wann ist ein günstiger Zeitpunkt? „Man wechselt das Register. Aus einem natürlichen Prozess – der abnehmenden Fruchtbarkeit – wird etwas Behandlungsbedürftiges.“
Die Herausforderung, Gleichberechtigung in der heutigen Arbeitswelt zu verwirklichen, drohe mit Social Freezing erneut vor allem den Frauen aufgebürdet zu werden – begleitet von dem technologischen Versprechen: Ihr kauft euch Zeit, damit ihr euren Kinderwunsch später verwirklichen könnt. Das verschleiere jedoch, dass der Erfolg, dann auch tatsächlich Kinder zu bekommen, alles andere als garantiert sei, sagt Lemke. „Der logische Weg wäre doch, Menschen in jüngerem Alter auf ‚natürlichem Weg‘ zu ermöglichen, Kinder zu bekommen – und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.“