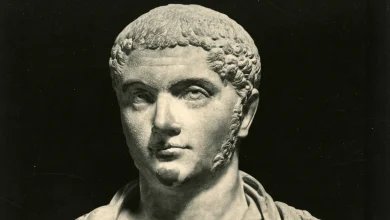Hepatitis A: Symptome, Ansteckung und Impfung | ABC-Z

Stand: 15.07.2025 17:47 Uhr
| vom
Hepatitis A (HAV), auch Reisehepatitis genannt, ist eine akut und nicht chronisch verlaufende Virusinfektion der Leber. Die Ansteckung erfolgt meist über Lebensmittel und Schmierinfektionen.
Das Hepatitis-A-Virus ist neben den Hepatitis-Viren B, C, D und E eines der fünf bekannten Hepatitis-Viren. Diese haben, obwohl sie grundsätzlich sehr unterschiedlich sind und auf unterschiedlichem Weg übertragen werden, eine Gemeinsamkeit: Sie verursachen Entzündungen der Leber (Hepatitis, stammt vom griechischen Wort “Hepar” für Leber). Die durch die unterschiedlichen Erreger ausgelösten Erkrankungen können lebensgefährlich verlaufen, teilweise chronisch werden, schwere Leberschäden – wie Leberzirrhose und Leberkrebs – verursachen und mitunter tödlich enden. Hepatitis-Erkrankungen sind in Deutschland meldepflichtig.
Hepatitis-A-Virus: Hochinfektiös, temperatur- und umweltstabil
Das weltweit verbreitete Hepatitis-A-Virus, kurz HAV, gehört zur Familie der Picornaviren. Das sind besonders kleine, kugelförmige, sogenannte einsträngige RNA-Viren, die bei Menschen häufig zu Erkrankungen führen. Zu dieser Virenfamilie gehören zum Beispiel auch die Rhino- und die gefährlichen Polioviren.
Der Mensch ist das einzige Reservoir des Hepatitis-A-Virus. Dabei ist das Virus besonders stabil – was Umweltbedingungen, Hitze, Kälte und sogar Desinfektionsmittel betrifft. Es kann vereinzelte Erkrankungen, örtliche Ausbrüche oder sogar Epidemien – also landesweite Erkrankungswellen – auslösen.
Hepatitis A: Kein chronischer, aber schwerer Verlauf möglich
Die gute Nachricht vorweg: Bei Erkrankungen durch das Hepatitis-A-Virus kommt es – im Gegensatz zu den Erregern der Hepatitis B, C und D – zu keinem chronischen Verlauf. Der kann sich in seltenen Fällen auch durch das Hepatitis-E-Virus entwickeln.
Bei mehr als 70 Prozent der Patientinnen und Patienten heilt eine Hepatitis-A-Infektion innerhalb weniger Wochen und Monate ohne Folgen aus. Wer die Infektion hinter sich hat, ist lebenslang immun.
Bei rund einem von 200 Erkrankten, vor allem bei älteren oder gesundheitlich vorbelasteten Menschen, kommt es aber zu einem fulminanten Verlauf. So nennen Medizinerinnen und Mediziner eine schwerwiegende Infektion, die lebensbedrohlich verlaufen kann. Todesfälle durch die Infektion mit HAV sind sehr selten.
Symptome einer Hepatitis-A-Infektion
Die hauptsächlichen Symptome einer Hepatitis-A-Infektion sind:
- allgemeines Krankheitsgefühl
- Übelkeit, Erbrechen und Schmerzen im Oberbauch, die durch eine Vergrößerung der Leber hervorgerufen werden
- Gelbsucht oder ikterische Phase: Das bedeutet eine Gelbfärbung der Schleimhäute, oft auch der Sklera, also der weißen, äußeren Hülle des Augapfels. Daran anschließen kann sich eine Dunkelfärbung des Urins durch vermehrte Ausscheidung von Bilirubin-Abbauprodukten mit begleitendem Juckreiz.
- Hautausschläge, die an Scharlach erinnern
- Vergrößerung der Milz
- oft nur sehr gering erhöhte Temperatur
Inkubationszeit und Ansteckungsgefahr
Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung und den ersten Symptomen, beträgt im Durchschnitt 28 bis 30 Tage, kann aber mit rund 15 Tagen deutlich kürzer, oder mit bis zu 50 Tagen auch deutlich länger sein. Ein bis zwei Wochen vor und circa die erste Woche während der Symptome besteht die größte Ansteckungsgefahr.
Hepatitis-A-Infektion: Übertragungswege und Ansteckungsrisiken
Das Hepatitis-A-Virus wird über den Darm ausgeschieden und kann damit über Schmierinfektionen – zum Beispiel der Hände – andere Menschen infizieren, die das Virus über den Mund aufnehmen. Besonders leicht passiert das in Familien oder Gruppeneinrichtungen.
Oft werden verunreinigte Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände zu Infektionsquellen, ebenso wie verunreinigtes Wasser, darin lebende Meeresfrüchte oder mit Fäkalien gedüngtes Gemüse. Auch eine Übertragung durch entsprechende Sexualpraktiken ist möglich.
HAV: Häufigkeit und Vorkommen
In westlichen Industrieländern haben hohe Hygienestandards in den vergangenen Jahrzehnten zu einem starken Rückgang der Infektionszahlen geführt. Da Hepatitis-Infektionen nach dem Infektionsschutzgesetz erfasst und gemeldet werden müssen, können Virusquellen oft schnell ermittelt, beseitigt und örtliche Ausbrüche eingedämmt oder verhindert werden. Deutschland zählt mit durchschnittlich rund einer Hepatitis-A-Infektion pro 100.000 Einwohnern zu den sogenannten Niedriginzidenzländern.
Reisehepatitis: Erhöhtes Risiko in vielen Ländern
Vor allem in Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien und auch in einigen Länder Südosteuropas ist das Infektionsrisiko aber deutlich erhöht. In manchen Ländern ist das Hepatitis-A-Virus endemisch, also über weite Flächen verbreitet. Knapp die Hälfte der hierzulande gemeldeten Erkrankungen geht auf Infektionen auf Reisen zurück.
Mögliche Infektionsquelle: Tiefkühlkost und getrocknete Früchte
Da das Virus besonders robust und temperaturstabil ist, kommt es auch hierzulande immer wieder zu Infektionen. Ein Beispiel dafür sind tiefgekühlte, virusbehaftete Beeren. Durch weltweit vernetzte Lieferketten gibt es Tiefkühlkost aus Ländern mit erhöhten Infektionsrisiken in vielen Supermärkten zu kaufen. Werden verunreinigte Produkte ohne ausreichendes Erhitzen zu Smoothies oder Kuchen verarbeitet, kann das – je nach Menge und Ausmaß – zu einzelnen Erkrankungen oder örtlichen Ausbrüchen führen. Das gilt auch für importierte Früchte wie zum Beispiel Datteln oder getrocknete Tomaten.
Infektionsquelle Kleinkinder und immunsupprimierte Menschen
Bei Kindern im Vorschulalter verläuft eine Hepatitis-A-Infektion in der Regel ohne Symptome. Dabei können Kleinkinder das Virus über längere Zeit ausscheiden und weiterverbreiten. Auch immunsupprimierte Patientinnen und Patienten können, wenn ihre typischen Symptome verschwunden sind, das Virus länger als gewöhnlich ausscheiden und so weiterverbreiten.
Diagnose: PCR-Test und Laboruntersuchungen
Sicher diagnostiziert wird die Infektion mit PCR-Tests, mit denen die RNA der Hepatitis-A-Viren im Stuhl oder Blut nachgewiesen wird. Über die Messung bestimmter Enzyme und Leberabbauprodukte, wie den Farbstoff Bilirubin im Blut und weitere im Urin, werden Entzündungen der Leber nachgewiesen. Bestimmte Antikörper weisen auf eine frische oder bereits zurückliegende Infektion hin.
Keine Therapie – Verzicht auf Alkohol
Eine ursächliche Therapie bei einer Hepatits-A-Infektion gibt es nicht, Patientinnen und Patienten müssen die Erkrankung sozusagen “aussitzen”. Lediglich die Symptome können gelindert werden – zum Beispiel durch eine angepasste Ernährung, wie den Verzicht auf besonders fetthaltige Speisen. Auf Drogen und auch Medikamente, die die Leber schädigen können, muss während der Erkrankung unbedingt verzichtet werden. Das gilt besonders für den Genuss von Alkohol.
Impfung gegen Hepatitis A
Zuverlässigen Schutz vor einer Hepatitis-A-Infektion bietet eine Impfung – eine aktive Immunisierung, die mit einem Totimpfstoff erfolgt. Die gute Nachricht: Die Impfung schützt selbst dann, wenn die erste Gabe wenige Wochen vor oder sogar kurze Zeit nach einer möglichen Ansteckung erfolgt. Denn der Impfstoff wirkt bereits, bevor sich die Infektion entwickelt.
Der sogenannte monovalente Impfstoff wirkt gezielt nur gegen Hepatitis A. Empfohlen werden zwei Gaben im Abstand von sechs bis 18 Monaten. Eine Auffrischung nach zehn Jahren scheint für einen Impfschutz, der über mehrere Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar lebenslang wirkt, heute nicht mehr nötig. Darauf weisen aktuelle Forschungen hin.
Kombinationsimpfung gegen Hepatitis A und B
Ebenfalls möglich ist eine Impfung mit einem Kombinationsimpfstoff gegen Hepatitis A und B. Da darin aber geringere Dosen der Hepatitis-A-Vakzine enthalten sind, werden für einen kurzfristigen Schutz gegen Hepatitis A unbedingt mindestens zwei Impfgaben benötigt. Die Kombinationsimpfung wird in drei Gaben mit einem und sechs Monaten Abstand nach der ersten verabreicht.
STIKO-Empfehlungen und Kostenübernahme
Die STIKO, die Ständige Impfkomission, empfiehlt die Impfung gegen Hepatitis A nur für gefährdete Personengruppen, bestimmte Berufsgruppen im technischen, sozialen und medizinischen Bereich sowie bei Reisen in Länder mit erhöhtem Infektionsrisiko. Da nicht alle Krankenkassen die Kosten für die Impfung übernehmen, sollten sich alle, die sich impfen lassen wollen, zuvor erkundigen, ob ihre Krankenkasse die Kosten übernimmt.
Expertinnen und Experten im Beitrag