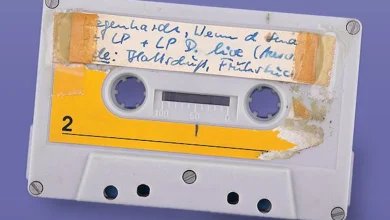Hans Stimmann: Der Stadtverliebte | DIE ZEIT | ABC-Z

Viele, die sich ein anderes, besseres Leben
erhofften, suchten es damals im Alten und Abgelegten. Gründerzeithäuser sollten
besetzt und bewahrt, die Denkmalschützer ermächtigt und die Idee einer
autogerechten Stadt überwunden werden, davon waren die progressiven Köpfe der
Sechziger- und Siebzigerjahre überzeugt. Auch Hans Stimmann gehörte dazu,
Arbeiterkind und Maurer, der ohne Abitur hatte studieren dürfen, in Berlin,
dank sozialdemokratischer Bildungsreformen. Stimmmann war Architekt und ein
höchst streitbarer Stadtplaner, der mächtigste in der von Baukränen
zugestellten Hauptstadt der Nachwendezeit. Das zerrissene, von Krieg und
Teilung entstellte Berlin sollte wieder heil und schön werden, das war das Ziel
des Senatsbaudirektors Stimmann. Ein Ziel, das ihn zum bestgehassten
Stadtplaner der Welt werden ließ.
Zaha Hadid, Rem Koolhaas oder Daniel
Libeskind, die namhaftesten Architekten sahen in Stimmann einen reaktionären
Traditionalisten – und nicht den geschichtsbewussten Reformer, als den er sich
selbst verstand. Er setzte auf das Leitbild der “europäischen Stadt”, wollte
überschießende Kapitalinteressen zähmen und einen neuen Zusammenhalt stiften,
geprägt von bürgerlichem Gemeinsinn. Egozentrische Bauskulpturen der
Avantgarde hielt er deshalb für abwegig, wichtig waren ihm Mäßigung und ein
Stadtbild, in dem sich die Bauwerke einfügen und anpassen: Geschlossene
Straßenfronten, einheitliche Traufhöhen, keine Glas-, sondern Steinfassaden –
das waren Stimmanns Ideale. Und sie bestimmen weite Teile des Nachwende-Berlins
bis heute.
Vor allem der alte Stadtgrundriss, die Idee einer
klein- und vielteiligen Architektur war ihm wichtig – traf aber bei den meisten
Architekten auf galligen Widerstand. Kritiker wie der jüngst verstorbene
Nikolaus Kuhnert warnten vor einem “Neuteutonia”, vor neudeutscher
Selbstherrlichkeit, die von den offenen Stadtlandschaften der Nachkriegszeit,
von den Ideen einer beschwingten, spielerischen Urbanität nichts übrig lassen
würde. Tatsächlich setzte Stimmann mit großem Nachdruck auf seine Idee einer
“kritischen Rekonstruktion”. Und die Träume von einer zwanglosen, entgrenzten
Stadt kamen dort so wenig vor wie das bauliche Erbe der DDR. Die Geschichte,
auf die sich Stimmann berief, meinte nicht die ganze Geschichte. Die Tradition
des Experiments, die Berlin über Jahrzehnte geprägt hatten, blieb
ausgespart.
Dafür aber waren das Gespräch über
Architektur, der Streit über Häuser, Straßen, Plätze nie lebendiger als in den
15 Jahren, in denen Stimmann die baulichen Geschicke Berlins prägte. Anders als
heute, da vieles in Gleichmut versinkt und die Monotonie der meisten Neubauten
schicksalsergeben hingenommen wird, sollte die Stadt damals alle angehen.
Stimmann, in seiner unnachahmlichen Entschiedenheit, war es gelungen, das
Gespräch der Gesellschaft mit sich selbst zu befeuern. Und obwohl er selten
zufrieden war mit dem, was aus seinen Ideen und Idealen wurde, blieb er Berlin
bis zuletzt verbunden – ein großer Verfechter des Urbanen und einer Stadt, die
erst im Widerstreit ihren Zusammenhalt findet.