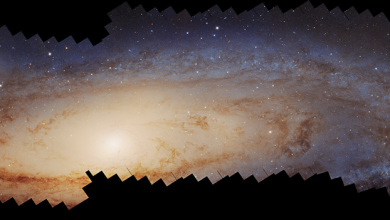György Kurtágs „Fin de partie“ an Berlins Staatsoper | ABC-Z

Das Bühnenbild hat ikonischen Charakter: Nach einer kurzen Umbaupause, deren Dunkelheit nicht wenige im Publikum nutzen, den Heimweg anzutreten, liegt ein umgestürztes Riesenrad auf der Bühne. Wie in aller Welt kommt das bühnenbreit daliegende Monstrum da hin? Ganz unkünstlerische Überlegungen drängen sich dem Betrachter auf: dass es eine hübsche Fleiß- und Kraftarbeit sein dürfte, all die Stangen, aus dem das Rad gebaut ist, durch die Gegend zu tragen und zusammenzusetzen. Das Große, Eindrucksvolle ist damit jedenfalls ein Teil von Johannes Eraths Inszenierung von György Kurtágs „Fin de partie“ an der Staatsoper Unter den Linden.
Das gewaltige Bild erzählt vom Untergang einer Zivilisation mit all ihren Spaßbedürfnissen. Damit ist der Regisseur Samuel Becketts Vorlage so nah wie fern: Von einer Katastrophe geht dieses Stück aus, von der vier Personen in die Klausur gezwungen werden. Was passiert ist, weiß der Betrachter nicht, ihm werden aber drei Mitglieder einer Familie vorgestellt nebst deren Faktotum, die allesamt um das drohende Ende wissen, die die Drohung aber möglichst beiseitezuschieben versuchen. In verdrängter Angst monologisieren sie vor sich hin, sinnieren („ein ganzes Leben wartet man, dass ein Leben daraus wird“), lassen Erinnerungen Revue passieren und erzählen Geschichten. Etwa vom Schneider, der – schön passend zum Thema des Stückes – mit seiner Arbeit an einer Hose kein Ende findet: aus Perfektionswahn, vielleicht aber auch aus purer Angst vor dem Ende. Das Symbolhafte der Konstellation liegt auf der Hand, eine Parabel in diesem Stück zu sehen auf das menschliche Leben selbst fällt nicht schwer, „ich könnte nicht erzählen, wovon es handelt, aber es handelt vom ganzen Leben“, sagt Kurtág selbst über sein und Becketts Stück.
Die klaustrophobische Situation schwächt Erath ab. Spätestens als das Riesenrad wie von einem Rübezahl umgetreten auf der Bühne liegt, ist der Raum geöffnet. Begonnen hatte der Abend noch ganz urtexttreu mit einem geschlossenen Guckkasten (Bühne: Kaspar Glarner), der einen abgewohnten Salon vorstellte. Renovierungsbedürftige Bürgerherrlichkeit des späten 19. Jahrhunderts: eichene Holzvertäfelung an den Wänden, edel gemusterte Tapete. Was hier dem Untergang entgegenblickt, scheint (jedenfalls im Bühnenbild) die Idee des Bürgertums schlechthin zu sein.
Hinzu kommen in Eraths Inszenierung weitere Motive, die der Regisseur aus der eigentümlichen Komik des Stückes abgeleitet sehen möchte. Das Zirkushafte spielt eine Rolle, wenn Hamm, der Sohn, der nur noch sitzen, aber nicht mehr gehen, und Clov, sein Helfer, der nur noch gehen, aber nicht mehr sitzen kann, im paillettenbestickten Glitzeranzug erscheinen (Kostüme: Birgit Wentsch). Stephan Rügamer als glänzender Charaktertenor spielt und singt Nagg, den Vater, mit clownesker Agilität. Noch auf die Entfernung wirken Kraft und Präsenz seiner Mimik und Gestik. Er erscheint bald in khakifarbenem Frack und passender kurzer Hose und erinnert dabei an einen Physikprofessor, der auf Zirkusdirektor umgeschult hat. Recht bunt das alles, nur komisch ist es nicht. Doch, einmal wird gelacht: als unvermutet ein Feuereffekt aus einem Teil des Riesenrades zündet. Ein Beispiel, wie Erath klangliche Höhepunkte in Kurtágs Musik auch auf der Bühne sich widerspiegeln lässt.

Die Dringlichkeit und Enge des Stücks ist mit der räumlichen Öffnung aufgehoben. Möglich, dass damit auch eine Kraftquelle aufgegeben wird. Kurtágs Musik entwickelt ihre besondere Qualität ja nicht zuletzt dadurch, dass sie in klaustrophobischer Situation einen neuen, wenn auch rein musikalischen Raum öffnet. Im Idealfall würde der Betrachter sich wohl aus der Enge, die er zu sehen bekommt, in die akustische Weite leiten lassen, die ihm Kurtágs Vertonung verheißt. Ein konzentriertes Zuhören wäre dabei die Folge, wie es die Musik des ungarischen Komponisten einfordert: Sie bietet sich dem Hörer nicht einladend an.
Ein erzählerischer Fluss, dem sich folgen ließe, stellt sich kaum einmal ein. Ihr Stammeln, ihr Zwiegespräch mit der Stille, die in den Pausen einbricht, von denen diese Musik durchsetzt ist, die feinen Unterschiede der Farbmischungen: All das muss sich der Hörer erarbeiten, am besten unbehelligt von optischer Ablenkung. Vielleicht griff Kurtág, der in vier Wochen 99 Jahre alt wird, deshalb zu Becketts mit allen Konventionen brechender Vorlage, als er, der Meister komprimierter Kleinstformen, sich im hohen Alter dazu verleiten ließ, eine Oper zu schreiben.
So stringent und delikat die Staatskapelle Berlin, geleitet von Alexander Soddy, diese Musik auch spielt: Das Zuhören fällt nicht leicht. Der fragmentarische Charakter der Musik wird plötzlich verstärkt durch ein Bühnengeschehen, dessen phantasiereiche Gestaltung ebenfalls fragmentarischen Charakter zeigt. Mit einem Mal wirken Zentrifugalkräfte. Stabilitätsanker sind die Sänger. Bo Skovhus als Diener Clove erinnert mit der Gestaltungsmacht seines strahlenden Baritons an die versteckte Würde seiner Rolle. Laurent Naouri verleiht dem Sohn Hamm die nötige Präsenz: Der kommandiert den Diener und ist grob mit den Eltern, die beinlos (ein Fahrradunfall ist schuld) in zwei Tonnen stecken. Stephan Rügamer und Dalia Schaechter geben sie als groteske Figuren. Auch wenn es dabei nichts zu lachen gibt: Das Publikum ist freundlich gesinnt. Warmer Applaus für sämtliche Beteiligte.