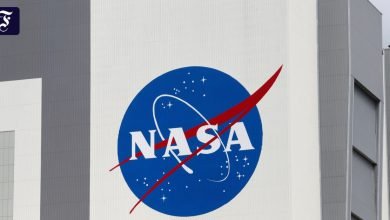EU-Kommission schlägt Erhöhung des EU-Haushalts auf zwei Billionen Euro vor | ABC-Z

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Europaparlament, Johan Van Overtveldt, war am Mittwoch nicht zu beneiden. Immer wieder musste er im Laufe des Tages den wartenden Ausschussmitgliedern mitteilen, dass sich die Präsentation des nächsten mehrjährigen EU-Budgets verzögert. Eigentlich sollte Haushaltskommissar Piotr Serafin die Zahlen schon gegen Mittag vorstellen. Die Europäische Kommission konnte sich jedoch lange nicht einigen. Die Sitzung sei von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht gut vorbereitet worden, hieß es aus der Kommission.
Frühzeitig klar war hingegen, dass die Kommission trotz der knappen Haushalte vieler Mitgliedstaaten eine spürbare Erhöhung des Budgets vorschlagen will. Für die siebenjährige Finanzperiode, 2028 bis 2034, sind nun Ausgaben von insgesamt zwei Billionen Euro (in laufenden Preisen) vorgesehen. Das entspricht rund 1,26 Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich: Die Gesamtausgaben des derzeitigen Haushaltsrahmens 2021 bis 2027 entsprechen rund 1,1 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Europäische Kommission begründet die Aufstockung mit den neuen Aufgaben, die auf die EU zugekommen sind, allen voran für die Verteidigung und die Wettbewerbsfähigkeit. Das Argument ist altbekannt. Es wird von der Kommission bei jeder Haushaltsverhandlung vorgebracht.
In absoluten Zahlen umfasst der laufende Finanzrahmen das nach Kommissionsangaben 1,2 Billionen Euro. Diese Zahlen sind mit dem neuen Vorschlag allerdings nicht vergleichbar. Dieser ist in laufenden Preisen kalkuliert, die 1,2 Billionen Euro in Preisen von 2020.
Den Hauptanteil des neuen EU-Budgets sollen auch künftig die Mitgliedstaaten mit ihren Beiträgen bestreiten. Diese machen bisher ungefähr vier Fünftel des Haushalts aus und orientieren sich weitgehend an der Wirtschaftsleistung. Es gibt aber für einzelne Länder Rabatte. So zahlt Deutschland weniger als die rund 25 Prozent, die es an der europäischen Wirtschaftsleistung hat. Hinzu kommen eigene Einnahmen, vor allem aus Zöllen.
Widerstand in der deutschen Wirtschaft
Den Anteil der Eigenmittel will die Kommission künftig um jährlich 58,2 Milliarden Euro erhöhen. Sie schlägt dafür mehrere neue Einnahmequellen vor. Dazu zählen eine neue Steuer für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro, eine Abgabe auf nicht verwerteten Elektroschrott und ein Anteil an den nationalen Tabaksteuern. Serafin sagte im Parlament, er hoffe, dass damit auch Einwände der Parlamentarier berücksichtigt worden seien. Die Einnahmen aus der neuen Unternehmenssteuer beziffert die Kommission auf 6,8 Milliarden Euro im Jahr.
Dass die EU neue Eigenmittel erhalten soll, hatten die Staats- und Regierungschef vereinbart, als sie 2020 die Aufnahme von EU-Schulden für den Corona-Fonds beschlossen. Sie sollen unabhängig von neuem Finanzbedarf bei der Rückzahlung dieser Schulden helfen, mit der die EU 2028 beginnen muss. Die Kommission rechnet mit einem jährlichen Betrag von 25 bis 30 Milliarden für Tilgung und Zinsen von diesem Zeitpunkt an. Bisher konnten sich die Staaten aber nicht auf konkrete Eigenmittel einigen. Erste Vorschläge der Kommission dafür liegen seit 2021 vor, etwa eine CO2-Grenzsteuer und eine Digitalabgabe sowie neue Einnahmen aus dem Emissionshandel.
In der deutschen Wirtschaft regt sich schon Widerstand gegen die neue Steuer für Unternehmen. „EU-weit wären schätzungsweise 50.000 Unternehmen betroffen, davon etwa 20.000 allein in Deutschland“, schätzt die Deutsche Industrie und Handelskammer (DIHK). Das ist allerdings auf die ursprünglich geplante niedrigere Schwelle von 50 Millionen Euro Umsatz bezogen. In einer Phase, in der die Wirtschaft mit strukturellen Herausforderungen, hoher Unsicherheit und verschärftem globalem Wettbewerb konfrontiert sei, wäre eine solche Maßnahme das völlig falsche Signal. „Wir können vor diesem Vorstoß nur warnen“, sagte Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov. Die Kommission konterkariere ihre Pläne für einen Bürokratieabbau zugunsten der Unternehmen. Besonders in Deutschland wären die Auswirkungen laut DIHK gravierend: Rund 40 Prozent aller von der Abgabe betroffenen Unternehmen hätten hier ihren Sitz. Eine Sonderabgabe würde nicht nur die geplante Unternehmenssteuerreform von 2028 an relativieren, sie könnte sie für größere Unternehmen sogar faktisch zunichte machen.
Der DIHK forderte die Bundesregierung auf, sich in Brüssel gegen diese Pläne einzusetzen. Berlin dürfte in der weiteren Debatte tatsächlich eine wichtige Rolle spielen, da Deutschland bisher der größte Finanzier des EU-Budgets ist. Für Deutschland dürfte entscheidend sein, ob eine neue Steuer das Land mehr oder weniger belastet als die nationalen Beiträge. Das dürfte bei der Abgabe für Großkonzerne der Fall sein. Es ist deshalb anzunehmen, dass sich die Bundesregierung eher dagegen positionieren wird.
Berlin meldet Vorbehalte an
In der Tat meldete die Bundesregierung am späten Mittwochabend Vorbehalte gegen den EU-Finanzrahmen an „Ein umfassender Aufwuchs des EU-Haushalts ist nicht vermittelbar in Zeiten, in denen alle Mitgliedsstaaten erhebliche Anstrengungen zur Konsolidierung der nationalen Haushalte unternehmen”, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. „Daher werden wir den Vorschlag der Kommission nicht akzeptieren können. Auch die von der EU-Kommission vorgeschlagene zusätzliche Besteuerung der Unternehmen findet nicht unsere Unterstützung.”
Allerdings sei der Reformansatz der Kommission und die Ausrichtung des Haushalts auf neue Prioritäten richtig; „Dieser Kurs ist richtig, um Europa stark zu machen für die Zukunft.” Europa stehe vor historischen Herausforderungen, auf die der nächste Finanzrahmen eine Antwort geben muss. „Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern und verteidigungsbereit werden. Europa muss global handlungsfähig sein”, sagte er.
Radikale Vorschläge für die Ausgaben
Noch radikaler als auf der Einnahmenseite sind die Vorschläge der Kommission für die Ausgaben. Die vorgeschlagene Aufteilung der Budget-Einzelposten fiele gröber als bislang üblich aus. Bisher sind alle Ausgaben langfristig weitgehend festgelegt. Die Kommission beklagt, dass im aktuellen Finanzrahmen 90 Prozent der Mittel von Anfang an klar zugewiesen sind. Das macht es schwer, auf Krisen wie den Ukrainekrieg zu reagieren. Zudem fehlt es an Geld für „moderne“ Ausgaben, wie die Rüstung oder die Wettbewerbsfähigkeit. Unter Letzteren versteht die Kommission auch Subventionen für die europäische Industrie. Sie will den Finanzrahmen deshalb viel flexibler gestalten. Die detaillierten Programme, etwa zur Regionalförderung, Agrarpolitik und anderen Politikfeldern, sollen wie ein großer Teil der diversen Fonds des EU-Haushalts verschwinden. Im Zentrum steht künftig ein Sammelfonds von 865 Milliarden Euro.
Dessen Mittel will die Kommission, wie die F.A.Z. schon im vergangenen Herbst exklusiv berichtet hatte, in Form von nationalen Zuschüssen an die EU-Staaten verteilen. Diese sollen im Gegenzug sogenannte Nationale und Regionale Partnerschaftspläne mit der EU-Kommission aushandeln. Darin sollen sie Reformen zusagen und Ziele für bestimmte Politikfelder festlegen. Die Liste möglicher Ziele im Entwurf ist lang: Sie reicht von der Energiewende über bezahlbaren Wohnraum bis zur Rüstung und den beiden klassischen Feldern Agrar- und Kohäsionspolitik.
Diese machten bisher jeweils ein Drittel des Gesamtbudgets aus. Ihr Anteil wird damit sinken, da für die Nationalen und Regionalen Partnerschaftspläne insgesamt weniger als die Hälfte des Gesamtbudgets vorgesehen sind. Die Kommission will den Landwirten aber 302 Milliarden Euro als Einkommenshilfen garantieren. Die am wenigsten entwickelten Regionen in Europa wiederum sollen mindestens 218 Milliarden Euro erhalten.
Der zweitgrößte Posten ist „Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Sicherheit“. Er soll den neuen Wettbewerbsfähigkeitsfonds in Höhe von 410 Milliarden Euro umfassen, mit dem die Europäische Kommission Projekte in vier Feldern fördern will: Künstliche Intelligenz und Digitales, grüne Technologien, Verteidigung und Gesundheit. Der drittgrößte Titel ist „Globales Europa“, in dem die gesamte EU-Außenpolitik aufgehen soll. Für die Verwaltung sind mehr als 100 Milliarden Euro vorgesehen. Darüber hinaus sind außerhalb des EU-Haushalts 100 Milliarden Euro für die Ukrainereserve vorgesehen.
Der Vorschlag der Kommission muss noch von Europaparlament und Mitgliedstaaten beraten werden.