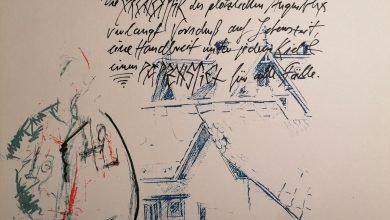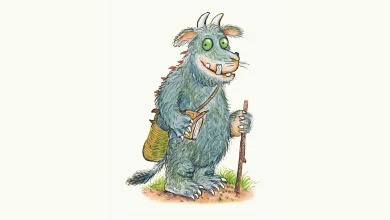Grand Egyptian Museum: Frankfurter liefern Tresore für die Schätze von Tutanchamun | ABC-Z

Das Archäologische Museum Frankfurt will das Ereignis auf einer großen Videoleinwand zeigen – denn Historiker und Ägypten-Fans in aller Welt warten schon seit Jahrzehnten darauf: Am Samstag soll im Beisein zahlreicher Staatsoberhäupter das Grand Egyptian Museum nahe den Pyramiden von Gizeh eröffnet werden. Für die Öffentlichkeit wird es vom 4. November an vollständig zugänglich sein. Besuche sind zwar schon seit 2024 möglich, doch die Schätze aus dem Grab des legendären Pharaos Tutanchamun sind in Gizeh erst dann zu besichtigen – und gut 50 davon in Vitrinen aus Frankfurt.
Die Schaukästen nämlich stammen vom Traditionsbetrieb Glasbau Hahn. Das Familienunternehmen hat sich schon in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts auf Museumsvitrinen spezialisiert und nicht zuletzt jenes Hochsicherheitsmodell gefertigt, in dem die goldene Totenmaske Tutanchamuns aufbewahrt wird. Sie war bis vor Kurzem im Ägyptischen Museum in Kairo am Tahrir-Platz zu besichtigen. Im neuen Grand Egyptian Museum wird sie erstmals zusammen mit allen anderen Schätzen aus der 1922 entdeckten Grabstätte gezeigt, insgesamt sind es mehr als 5000 Stücke.
Millionenschwerer Auftrag
Hahn hat auch für weitere Galerien im neuen Museum Vitrinen gebaut, 155 insgesamt. Die ersten seien 2019 montiert worden, die letzten Mitte 2024, teilt Isabel Hahn mit, eine der drei Gesellschafterinnen des Unternehmens. Gezahlt habe Ägypten einen zweistelligen Millionenbetrag – mehr will Hahn zu den Preisen nicht sagen.
Warum die ägyptische Regierung ein deutsches Familienunternehmen, das etwa 90 Mitarbeiter beschäftigt, mit dem Bau der gläsernen Tresore betraut hat, wird bei einem Rundgang durch dessen Werkstätten an der Gwinnerstraße im Frankfurter Stadtteil Seckbach deutlich.
Hahn arbeitet auch für George Lucas
Hier wird schon an neuen Spezialvitrinen gearbeitet – zum Beispiel für das geplante „Lucas Museum of Narrative Art“, das der Star-Wars-Produzent George Lucas nächstes Jahr in Los Angeles eröffnen will. Fotos von den Bauarbeiten zeigen ein flaches, geschwungenes Gebäude, das an ein Raumschiff erinnert.
Kurvenreich sind auch die Vitrinen, die Glasbau Hahn für das Lucas-Museum baut – Fotos davon dürfen derzeit noch nicht gezeigt werden. In der Werkstatt ist aber zu sehen, wie viel Mühe die ungewöhnlichen Formen machen. Ein Schweißer arbeitet an einem geschwungenen Bauteil aus Aluminium, in das die Lichter für eine der Lucas-Vitrinen eingesetzt werden sollen. Neben Aussparungen für die Lampenfassungen muss er Schächte anlegen für den Fall, dass später eine Leuchte in der Mitte ausgetauscht werden muss, denn die beiden geraden Kanten des Aluminium-Teils messen etwa 1,50 mal einen Meter.
Zu dem Lucas-Auftrag zähle auch eine Vitrine „von der Größe eines Mini-Appartements“, sagt Peter Hohenstatt, Leiter des Marketings und der Geschäftsentwicklung bei Glasbau Hahn. Zehn Meter breit und zwei bis drei Meter tief solle die Vitrine werden, bei einer Höhe von drei Metern.
Schwieriger Transport
Die größte Glasplatte, die Hahn jemals ausgeliefert hat, maß drei mal fünfzehn Meter. Ein Museum in Tokio habe sie als Frontscheibe für eine Vitrine gebraucht, in der große Wandgemälde ausgestellt werden sollten, sagt Hohenstatt. Für ihren Transport vom Hafen zum Museum seien damals einige Straßen in der Innenstadt von Tokio gesperrt worden.
Derartige Komplikationen bei der Lieferung sind selten – ein beachtliches Gewicht bringen aber auch schon kleinere Vitrinen auf die Waage. Aus Sicherheitsgründen sind viele aus einbruchssicherem Glas gefertigt, die Sockel und Rahmen aus Stahl. Eine Hochsicherheitsvitrine mit einer Grundfläche von einem Quadratmeter und zwei Meter Höhe wiegt Hohenstatt zufolge etwa zweieinhalb Tonnen.
Kontrolliertes Mikroklima
Die wohl größte Herausforderung für die Ingenieure und Handwerker des Unternehmens aber ist es, Museumsstücke vor dem Zahn der Zeit zu schützen. „Wir versuchen, in den Vitrinen stabile Klimata zu schaffen“, erläutert Hohenstatt. Glasbau Hahn fertigt dafür eigene Geräte – Luftbefeuchter und -entfeuchter zum Beispiel, aber auch Stickstoff-Generatoren. Die werden benötigt, um aus Vitrinen für Mumien den Sauerstoff zu verdrängen, der für Menschen zwar lebensnotwendig, für ihre sterblichen Überreste aber schädlich ist.
Diese und andere Geräte werden von außen an die Schaukästen angeschlossen und je nach Größe im Sockel oder in Nebenräumen verborgen. Denn natürlich sollen in den Vitrinen nur die Ausstellungsstücke zu sehen sein. „Unsere drei großen Themen sind Ästhetik, Sicherheit und präventive Konservierung“, sagt Hohenstatt.
Dass es Glasbau Hahn gut gelingt, diese drei Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen, zeigt ein Blick auf die Referenzen des Unternehmens. Vitrinen der Frankfurter schützen nicht nur Tutanchamun, sondern auch den weltberühmten Rosetta-Stein im British Museum, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung oder die Holbein-Madonna, die früher im Frankfurter Städel hing und seit 2012 in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall zu sehen ist. Und das sind nur einige Beispiele.
Es begann mit einem Spezialzement
Dass sich das 1829 unter dem Namen Schön’sche Glaserwerkstatt gegründete Unternehmen auf Vitrinen spezialisiert hat, hängt mit einer Erfindung zusammen: 1931 entwickelte Otto Hahn, ein Neffe des gleichnamigen Chemienobelpreisträgers, einen aus den USA mitgebrachten Spezialzement so weiter, dass damit Glasscheiben miteinander verklebt werden konnten. Hahns Glaskitt ermöglichte erstmals den Bau von Vitrinen ohne Rahmen; 1937 stellte das Unternehmen auf der Pariser Weltausstellung die erste Ganzglasvitrine vor. 1965 folgte ein Patent für die sogenannte Hängeverglasung, die die Nutzung großer Glasflächen für Fassaden erleichterte. Von einem „Meilenstein für die moderne Architektur“ spricht Hohenstatt.
Ihre Glasplatten beziehen die Frankfurter von verschiedenen Lieferanten. In den vergangenen Monaten haben in Deutschland mehrere Flachglashersteller Produktionskürzungen oder Werksschließungen angekündigt – die wichtigsten Gründe dafür sind die hohen Energiekosten und die Krise der Autoindustrie.
Das verringerte Angebot an Flachglas mache sich bei den Preisen bemerkbar, sagt Hohenstatt. Glasbau Hahn habe stets einen größeren Vorrat an Platten auf Lager, denn Aufträge zu verschieben, wenn gerade kein günstiges Glas verfügbar sei, sei keine Option: „Pünktliche Lieferungen sind für unsere Kunden essenziell.“ Denn wenn ein besonderes Ausstellungsstück neu präsentiert werde oder gar ein ganzes Museum neu eröffnet werde wie jetzt in Ägypten, „dann kommt der Präsident – und dessen Termine werden lang im Voraus festgelegt“.