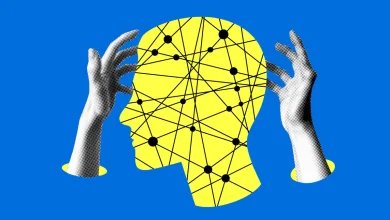Globaler Wasserkreislauf ist erratischer und extremer geworden – Wissen | ABC-Z

Regen fällt in der Sahara nur spärlich, das weiß jedes Kind. Vor gut einem Jahr geschah aber etwas Ungewöhnliches im Nordwesten der größten Trockenwüste der Erde. Auf dem Atlantik baute sich ein Wirbelsturm auf und nachdem er Unmengen an Ozeanwasser aufgesaugt hatte, zwirbelte er sich in den afrikanischen Kontinent hinein. Dort verteilte er gleich einer gigantischen Bewässerungsmaschine Regen über die karge und baumlose Landschaft Marokkos, Algeriens, Tunesiens und Libyens. In nur zwei Tagen ergossen sich Regenmengen, wie sie in den betroffenen Gebieten sonst im ganzen Jahr fallen. Flüsse schwollen an und trockengefallene Seen füllten sich wieder. Dörfer und Städte wurden überflutet, die zuvor jahrelang eine Dürre erlebt hatten.
Über das Jahr 2024 hinweg erschienen in den Nachrichten immer wieder Bilder von schier endlosen Wasserlandschaften – aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Iran und Afghanistan, aus Russland, den USA, China, Vietnam oder den Philippinen. Aber auch nach Deutschland kamen die Fluten, etwa nach Dinkelscherben im Landkreis Augsburg, wo tagelanger Dauerregen das Zentrum der Marktgemeinde im Juni unter Wasser setzte.
Nun liegt mit dem Report zur Lage der globalen Wasserressourcen 2024 der Weltwetterorganisation (WMO) eine Bilanz solcher Extremereignisse vor. Insgesamt ein Drittel aller Flüsse in Europa führten demnach im vergangenen Jahr zeitweise Hochwasser. Von den Überschwemmungen auf dem Kontinent waren mehr als 400 000 Menschen betroffen, 335 Menschen starben. „Das war schon außergewöhnlich“, sagt Stefan Uhlenbrook, Direktor der WMO-Abteilung für Wasser und Kryosphäre und Mitautor des Wasserberichts. „Wir haben viele Überschwemmungen gesehen, mehr als in früheren Jahren.“
„Wenn es regnet, dann knallt es häufig richtig“
Natürlich: Wetter ist variabel; auf ein insgesamt zu trockenes Jahr folgt auch mal ein besonders feuchtes. Und doch sieht etwa Sulagna Mishra, die Koordinatorin des WMO-Berichts, im Wasserhaushalt der Erde grundlegende Veränderungen. „Wir beobachten Verschiebungen in den Regenmustern, Windmustern, erratischere Regenfälle in Regionen, die es eigentlich nicht gewohnt sind, so viel Regen zu bekommen“, erklärte die Hydrologin in einer Pressekonferenz des britischen Science Media Centres. „All das hat der Klimawandel angestoßen.“
2024 war global das wärmste Jahr, das je gemessen wurde, die mittlere Temperatur lag 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Wert und damit in einem Bereich, den Klimamodelle erst für das Ende dieses Jahrzehnts erwartet hatten. Für den Rekord machen Klimaforscherinnen und Klimaforscher neben den anthropogenen Treibhausgasen unter anderem das natürliche Wetterphänomen El Niño verantwortlich. Aus den wärmeren Ozeanen und Seen konnte im Jahr 2024 deshalb mehr Wasser als gewöhnlich verdunsten, die wärmere Luft konnte mehr Wasser aufnehmen und der Boden schneller austrocknen. „Das bedeutet: Wenn es regnet, dann knallt es häufig richtig“, sagt Uhlenbrook.
Wie in Südamerika, wo im Mai 2024 extreme Regenfälle im Süden zu Rekordfluten führten und einen Damm am Barra Mansa Fluss brechen ließen – das zerstörerischste Hochwasserereignis in Brasilien der vergangenen 80 Jahre. Während der Süden des Kontinents absoff, trocknete der Norden aus: Begünstigt durch den einsetzenden El Niño dehnte sich über weite Teile des Amazonas-Beckens eine Dürre aus und ließ den Wasserpegel des Rio Negro bei Manaus im Oktober auf ein Allzeittief sinken. Die Trockenheit beförderte im Amazonas-Regenwald die Ausbreitung von Feuern – fast drei Prozent des Bioms verbrannten. „Auf die Gleichzeitigkeit von zu viel oder zu wenig Wasser müssen wir uns in Zukunft vermehrt einstellen“, sagt Uhlenbrook. „Der Wasserkreislauf wird zunehmend unberechenbarer und erratischer.“
Allein in Tadschikistan sind mehr als 1000 Gletscher verschwunden
Das spiegelt sich dem WMO-Bericht zufolge auch in den Flüssen der Welt wider: Im Jahr 2024 führten rund 30 Prozent der Flüsse zu wenig Wasser, 30 Prozent zu viel. In Zukunft könnte so ein Jahr typisch sein – mit vielen Extremereignissen und dem „Hang zu zu nassen und zu trockenen Bedingungen“, meint Uhlenbrook.
Während viele Menschen 2024 über ein zu viel an Wasser klagten, fehlte es einem großen Teil der Weltbevölkerung genau daran: 3,6 Milliarden Menschen hätten einen unzureichenden Zugang zu Wasser für mindestens einen Monat im Jahr gehabt, heißt es im WMO-Bericht. Bis 2050 dürfte sich die Zahl auf fünf Milliarden erhöhen.
Das liege auch am Schwund der Gletscher. 2024 hätten alle Gletscherregionen der Welt zusammen 450 Gigatonnen an Eis verloren. Das entspricht etwa einem Eisblock, der je sieben Kilometer hoch, breit und tief ist. So viel Eis wie nie zuvor gemessen verlor im Jahr 2024 etwa die Antarktis, wo die größten Eismassen der Welt lagern.
2024 schrumpften die Gletscher laut WMO-Report zum dritten Jahr in Folge überall auf der Welt. „Seit den neunziger Jahren sehen wir, dass sich die Gletscher im weltweiten Schnitt zurückziehen“, sagt Uhlenbrook. Aber bis vor drei Jahren habe es immer noch irgendwo auf der Erde eine Region gegeben, in der die Gletscher noch gewachsen sind.
Viele kleinere Gletscher haben bereits den Höhepunkt ihres Schmelzwasserabflusses überschritten. Das heißt, zunächst ist immer mehr Eis geschmolzen und entsprechend viel Schmelzwasser abgeflossen. Irgendwann aber ist der Gletscher so sehr geschrumpft, dass der Schmelzwasserfluss wieder abnimmt. Das erschwert die Wasserversorgung, etwa in Tadschikistan, wo bereits mehr als 1000 der einst 14000 Gletscher verschwunden sind. Da hier der Großteil der Trinkwasserversorgung vom Schmelzwasser der Gletscher abhängt, droht Tadschikistan in den nächsten Jahrzehnten eine Wasserkrise. Das Land startete deshalb eine Initiative, welche die Vereinten Nationen aufgriffen. Sie erklärten 2025 zum „internationalen Jahr des Gletscherschutzes“.