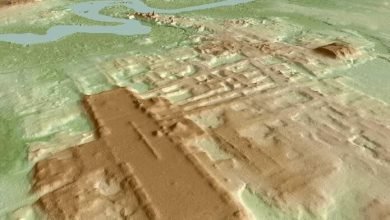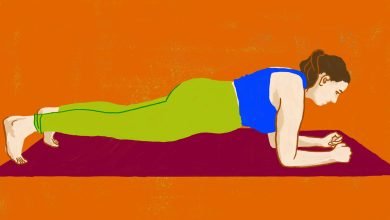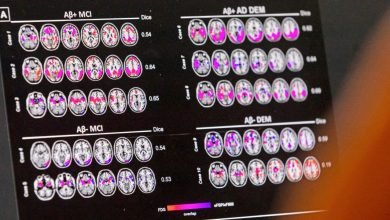Globale Erwärmung: „Ein starrer Naturschutz steht dem Klimawandel hilflos im Unterschied zu“ |ABC-Z

In Zeiten der globalen Erwärmung verlieren starre Schutzkonzepte für bedrohte Pflanzen und Tiere ihre Wirkung. Experten fordern mehr Flexibilität. Das erfordert praktische Anpassungen.
Ob Nationalpark, Biosphärenreservat oder Naturdenkmal – Deutschland ist übersät von rund 9000 größeren und kleineren Schutzgebieten, die in besonderer Weise Rücksicht auf seltene und bedrohte Tier- und Pflanzenarten nehmen. Schutzmaßnahmen sind darauf ausgerichtet, einen bestimmten Zustand der Natur möglichst langfristig zu bewahren.
Wie etwa die Lüneburger Heide, die eine übernutzte und degenerierte Waldlandschaft war, als sie 1911 zu einem der ersten großen Naturschutzgebiete Deutschlands erklärt wurde. Dank intensiver Pflege durch grasende Heidschnucken ist eine offene Landschaft erhalten, sonst wäre längst ein Wald nachgewachsen.
Zunehmend aber bringt der Klimawandel ein so starres Konzept von Naturschutz ins Wanken. Die Temperaturen steigen. Die Vegetationszeit beginnt früher und dauert länger an. Sommer werden heißer und trockener, Winter milder und regenreicher. Das verändert die Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere. Welcher Zustand kann jetzt noch Maßstab sein? Das deutsche Naturschutzgesetz ist vor allem auf den Erhalt des Status quo ausgerichtet, ebenso das EU-Recht. Die europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) schreibt im Detail vor, was zu schützen ist.
Professor Kai Niebert, Nachhaltigkeitsexperte an der Universität Zürich und Präsident des Deutschen Naturschutzrings, sieht die Regelungen kritisch. Auch die erst im vergangenen Jahr verabschiedete EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur hält er für zu statisch: „Welche Natur ist gemeint? Die vor 50 Jahren? Oder vor Beginn der Industrialisierung?“ Es gehe nicht mehr darum, Natur zu erhalten, die als schön und natürlich im Sinne von angestammt empfunden werde. Ein solcher „musealer Naturschutz“ habe ausgedient, so Niebert. „Wir müssen Natur dynamischer denken.“
Gerade im Klimawandel zeigt sich die Dynamik der Natur. Was sich früher schleichend eher über Jahrhunderte hinzog, läuft jetzt wie im Zeitraffer ab. Die seltene Alpen-Mosaikjungfer zum Beispiel, eine Großlibelle, mag es kühl und fühlt sich erst in Höhen ab 700 Metern so richtig wohl. Vor jedem Zehntelgrad mehr flüchtet sie jetzt Meter um Meter nach oben. Doch ihre Ausweichmöglichkeiten sind begrenzt. Jenseits der Gipfel ist Schluss. Dann droht die Art zu verschwinden.
Dem Kabeljau wird es zu warm
Auch der Kabeljau kommt in seiner angestammten Heimat nicht mehr zurecht. Seit sich die südliche Nordsee erwärmt, weicht seine Hauptnahrung, der Ruderkrebs, in den kühleren Nordatlantik aus, und er muss seiner Beute folgen, um zu überleben. Ein Profiteur des wärmeren Klimas ist etwa die Europäische Stechpalme. Sie war bislang eher typisch für den Mittelmeerraum. Inzwischen ist bereits bis in den Süden von Dänemark und Schweden vorgedrungen.
Arten wandern aus, andere tauchen auf. Die Unterscheidung in heimische und gebietsfremde Arten, so Niebert, sei letztlich historisch bedingt. Wer weiterhin auf stabile Rahmenbedingungen setze, laufe der Realität hinterher. „Ein konservierender Naturschutz steht dem Klimawandel hilflos gegenüber“, sagt Niebert.
Statt die Energie darauf zu konzentrieren, die Natur in einem bestimmten Zustand festhalten zu wollen und wie Sisyphos gegen das Unvermeidliche anzukämpfen, sollte der Naturschutz die Natur als das betrachten, was sie ist: ein sich stetig neu entwickelnder Lebensraum. Oder, wie Stefan Heiland, Professor für Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung an der TU Berlin, es formuliert: Natur ist kein starres Bild, sondern ein „lebendiger Film“.
Was bedeutet das für den Naturschutz? Beide Experten plädieren dafür, Funktionen von Natur zu sichern, wie etwa Bodenschutz oder Grundwasserbildung. Wiedervernässte Moore und Auen können klimarelevantes Kohlendioxid speichern und zugleich die Schäden durch Extremwetter wie Dürren oder Starkregen mindern. Intakte Wälder wirken wie eine Klimaanlage. Niebert beschreibt den neuen Ansatz von Naturschutz so: „Wir müssen die Natur so gestalten, dass sie uns Menschen schützen kann.“
Statt Natur wie unter einer Käseglocke zu konservieren, will Niebert Landschaften sich entwickeln lassen und manchmal auch gezielt verändern. Der Aufbau einer im Grundgesetz verankerten Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung und Naturschutz von Bund und Ländern könnte künftig die Umsetzung entsprechender Maßnahmen finanzieren und koordinieren. Angesichts des Klimawandels, so Niebert, dürfe sich Naturschutz nicht länger in einem zersplitterten Klein-Klein verlieren. Das bestehende „wilde Mosaik“ von geschützten Flächen müsse miteinander verbunden werden.
Naturschutz muss immer die Vernetzung von Schutzgebieten mitdenken, fordert auch die Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, Sabine Riewenherm, und nennt als positives Beispiel das Grüne Band entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze: eine geschützte Fläche in Nord-Süd-Ausrichtung, die es Pflanzen und Tieren erlaubt, entlang dieser Achse ihre Lebensräume zu verlagern.
Neu sei die Dynamik, mit der sich Veränderungen als Folge des Klimawandels vollziehen. „Da beobachten wir eine Beschleunigung, auf die der Naturschutz reagieren muss“, sagt Riewenherm. Das hat bereits ganz praktische Konsequenzen. Bei bestimmten Förderverfahren in der Landwirtschaft ist festgelegt, zu welchen Terminen eine Fläche in einem Schutzgebiet gemäht werden muss. Verschieben sich Vegetationsperioden, müssen solche Vorschriften angepasst werden. Riewenherm: „Da brauchen wir in Zukunft mehr Flexibilität.“