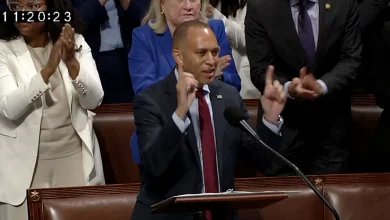Gesamtverteidigung: Wie wehrhaft ist Deutschland? | ABC-Z

Zu Beginn wird ein Film gezeigt: Nachrichten vom Kriegsverlauf im Baltikum. Russlands Präsident Wladimir Putin habe die Annexion von Estland, Lettland und Litauen verkündet, sagt der Nachrichtensprecher. NATO-Soldaten sei es nicht gelungen, vorrückende russische Truppen aufzuhalten. Hunderte in Litauen stationierte Bundeswehrsoldaten seien getötet, zahlreiche gefangen worden, Tausende Menschen auf der Flucht.
Deutschland sei auf die Eskalation schlecht vorbereitet gewesen, der Transit der verbündeten Truppen durch die Bundesrepublik verlaufe zu langsam, die Versorgung der Soldaten sei ungenügend, Grund seien unter anderem Engpässe beim Personal. In ganz Deutschland sei Luftalarm ausgerufen worden. „Bitte begeben Sie sich zügig in Schutzräume und bewahren Sie Ruhe.“
An der Stelle entsteht etwas Unruhe im Saal; in Hamburg gibt es keinen einzigen funktionierenden Schutzraum mehr. Der Film ist wohl der Albtraum vieler Soldaten hier an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Aber die Nachrichten sind frei erfunden. Die Videosequenzen sind aus dem Kontext genommen und mit Kriegsszenarien betextet worden. Andere fiktive Nachrichtensendungen, die gezeigt werden, handeln von hybriden Attacken etwa auf LNG-Terminals, von Zwischenfällen in Industrieanlagen und Flughäfen, von Stromausfällen und Unterbrechungen der Wasserversorgung. Fiktiv alles. Doch es braucht nicht viel, um sich vorzustellen, wie wir von den fast alltäglich gewordenen echten Meldungen über hybride Attacken und russische Truppenansammlungen hin zu derartigen Situationen zu kommen.
Aktuell nicht durchhaltefähig
Erstellt wurden die Filme vom aktuellen Jahrgang des Generalstabs- und Admiralstabslehrgang der Führungsakademie der Bundeswehr. Der präsentierte am Mittwoch seine Arbeit. Der Lehrgang umfasst traditionell das künftige Spitzenpersonal der Bundeswehr; wer ihn absolviert, landet später meist in Führungspositionen. Dieses Mal sind 113 Deutsche und 19 Personen von NATO-Staaten dabei.
Fast zwei Jahre lang haben sie sich mit dem Thema „Gesamtverteidigung in Deutschland“ befasst, formulierten Handlungsempfehlungen und machten Planspiele. Etwa dazu, wie die Bundesrepublik damit klarkäme, wenn täglich 1000 neue Verwundete behandelt werden müssten, während die Infrastruktur unter Druck wäre. Das Ergebnis in diesem Fall fällt ernüchternd aus: Unser System wäre aktuell nicht durchhaltefähig. Und das Ergebnis grundsätzlich ist ähnlich: Zwar hat sich in Sachen Verteidigung zuletzt einiges getan. Aber der Weg zu einem wirklich wehrhaften Land ist noch sehr weit.
Unter Gesamtverteidigung wird das Zusammenspiel von militärischer und ziviler Abwehr verstanden. Hintergedanke dabei: eine widerstandsfähige Bevölkerung, die mit Krisen gut klarkommt und die Armee unterstützt, wirkt abschreckend auf potentielle Angreifer. Die nordischen Staaten, vor allem Finnland und Schweden, gelten dabei als Vorbilder. Vielfach werden sie an diesem Tag in Hamburg genannt. Die Teilnehmer des Generalstabslehrgangs waren selbst dort zu Besuch während ihrer Ausbildung, um zu lernen.
Schweden war zu Zeiten seiner Bündnisfreiheit im Kalten Krieg hervorragend bei der zivilen Verteidigung aufgestellt. Danach hat man das Thema vernachlässigt, aber nun wird rasch vieles reaktiviert: Schutzbunker werden ertüchtigt und die Bevölkerung erhält Ratschläge für das Verhalten bei Krisen und Konflikten. Dabei geht es etwa darum, was jeder stets Zuhause haben sollte, aber auch um das Verhalten im Falle eines Luftangriffs.
Europas Vorzeigebeispiel in Sachen Gesamtverteidigung aber ist Finnland, das Russland auch in den guten Jahren nie getraut hatte. Die finnische Bevölkerung gilt als äußerst krisenresilient; viele nehmen an Verteidigungskursen oder Erste-Hilfe-Schulungen teil und fast jeder Mann hat Militärerfahrung. Spricht man mit Militärs in den nordischen Staaten, dann sagen diese, Rückgrat der Abwehrbereitschaft und der Resilienz in der Bevölkerung sei die Wehrpflicht – schließlich sorge diese dafür, dass militärisches Wissen in der Bevölkerung verbreitet sei. Ohne Wehrpflicht gibt es demnach keine wirksame Gesamtverteidigung.
„Irgendeine Form eines Wehrdiensts“
Gilt das auch für die Bundesrepublik? Hier ist die Wehrpflicht weiterhin ausgesetzt. Um das Thema geht es an diesem Tag in der Führungsakademie oft. Die derzeitige Debatte um die Wehrpflicht beschäftigt die Soldaten. Der Lehrgangsleiter des aktuellen Jahrgangs, Oberst Matthias Weber, sagt: Entscheidend sei, dass es hierzulande gelinge, den Bürgern deutlich zu machen, dass eine Wehrpflicht oder ein Dienstjahr Sinn ergebe. Andernfalls bleibe die Debatte über eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht „künstlich“. Es brauche eine Einsicht in die Notwendigkeit eines Dienstes für das eigene Land. Das sei in Schweden und Finnland der Fall, nur dann könne eine Wehrpflicht erfolgreich sein. Und nur dann könne wohl auch eine zivile Verteidigung wirklich wehrhaft werden, so Weber.
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, sagt dazu in Hamburg: Um die NATO-Ziele mitsamt dem geplanten Aufwuchs an Soldaten zu erreichen, brauche es „in irgendeiner Form einen Wehrdienst“. Aber nicht nur damit könnten militärische Belange in der Bevölkerung verankert werden. Das erfolge etwa auch durch Einsätze der Bundeswehr im Ahrtal oder bei Gesprächen mit Soldaten im Zug. Die Bundeswehr sei in die Bevölkerung gut eingebunden.
Deutschlands oberster Militär absolvierte selbst den Generalstabslehrgang der Führungsakademie, das war Ende der neunziger Jahre. Den aktuellen Lehrgang beauftragte er vor rund zwei Jahren, sich mit dem Thema Gesamtverteidigung auseinanderzusetzen. Schließlich erlebe man hybride Angriffe mittlerweile auch in Deutschland tagtäglich, so Breuer. Der Gegner nutze die Offenheit der Gesellschaft aus, wolle Angst schüren.
Aus Breuers Sicht hat sich die Bundesrepublik in den vergangenen 30 Jahren angewöhnt, in Schubladen zu denken: Frieden, Krise, Krieg, alles sauber definiert. Aber die Angriffe erfolgten derzeit in einer Grauzone. Krieg werde nicht mehr erklärt, sondern beginne mit Desinformation, Sabotage und Cyberattacken, so Breuer. Es gelte die Schubladen zu öffnen, vernetzt zu reagieren. Bund, Länder, Kommunen, ziviler und militärischer Bereich gemeinsam. „Sicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nur gemeinsam können wir eine Bedrohung abwehren“, sagt Breuer. Und bei dieser Gesamtverteidigung habe Deutschland „Nachholbedarf“.
Wer ist überhaupt zuständig?
Die Probleme beginnen schon bei der Frage der Zuständigkeit. Zivilschutz, also der Schutz der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall, ist in Deutschland Sache des Bundes. Katastrophenschutz, also der Schutz im Falle einer Naturkatastrophe, wiederum ist Sache der Länder. Nun ist aber bei hybriden Angriffe oft nicht klar, wer sie verursacht. Innere und äußere Sicherheit verschwimmen zunehmend – was eine klare Zuständigkeit erschwert. So sind etwa Drohnenüberflüge Sache der Länder. Aber nicht, wenn sich dahinter eine Gefahr durch Russland verbirgt.
In einem Beispiel entwickelten Teilnehmer des Lehrgangs Ideen für ein Szenario, bei dem ein Großteil der Bundeswehr an der Ostfront im Einsatz ist, während im Land die hybriden Angriffe zunehmen und zugleich die „Drehscheibe Deutschland“, also der Transport und die Versorgung alliierter Truppen quer durchs Land, bewerkstelligt werden muss. Dann bräuchte es massenhaft Reservisten, die Deutschland aber nicht hat. Und bei den vorhandenen Reservisten weiß die Bundeswehr oft schlicht nicht mehr, wer was kann und was er gerade macht. Vorschlag der Lehrgangsteilnehmer: Ein mit künstlicher Intelligenz gestütztes Simulationstool, mit dem ein besserer Überblick über die Reserve erfolgen soll. Ob das ausreicht, ist sehr fraglich.
Laut Breuer könnte Russland 2029 bereit sein, NATO-Staaten militärisch anzugreifen. Damit das nicht passiere, gelte es, gesellschaftliche Resilienz herzustellen und militärisch zu rüsten. Bei allen düsteren Szenarien versucht der studierte Pädagoge Breuer an diesem Tag auch Optimismus zu verbreiten. In beiden Bereichen, bei der Rüstung wie der gesellschaftlichen Resilienz, habe Deutschland zuletzt einen „deutlichen Schritt“ nach vorne gemacht, sagt er und verweist darauf, wie viel mehr das Land sich mit den Themen mittlerweile auseinandersetzt und welche Unterstützung die Bundeswehr erhalte.
Doch nicht alle in der Bundeswehr teilen diesen Optimismus. Die Situation insgesamt mache ihm große Sorgen, sagt ein Soldat. Es gebe in Teilen der Bundeswehr große Zweifel, ob „wir’s wirklich drauf haben“. Und was die Ideen der Lehrgangsteilnehmer angehe: Jene, die da die Vorschläge machten, würden wohl kaum später im Kriegseinsatz an der Front stehen.