Georgi Demidow: Hier gräbt der Wurm des Zweifels | ABC-Z
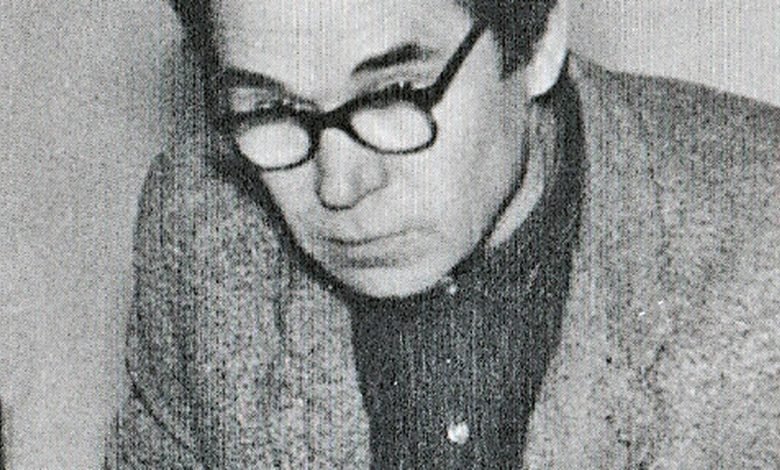
Es gibt Sätze, in denen schon die
ganze Erklärung dafür zu stecken scheint, warum Georgi Demidows Literatur bis
zum Ende der UdSSR eine Gefahr für das System und damit undruckbar war. “Gewissen
ist etwas für Menschen”, lautet ein solcher Satz im Kurzroman Zwei
Staatsanwälte, “die nicht in der Lage sind, ihre Handlungen, meist
wegen deren Geringfügigkeit, auf die philosophische Grundlage der
Rechtfertigung durch historische Zweckmäßigkeit zu stellen.” Demidow ist
kein Autor knalliger Anklagen, sondern von feinsinnig verschachtelten Gedanken:
Gewissen ist etwas, das sich mit der Einsicht in Zweckmäßigkeit verflüchtigt,
dessen moralische Grundierung man sich leisten können muss, oder die nur
aufleuchtet, weil man sich in der Irrelevanz erschöpft. Ein Gewissen überlebt
in Kurzsichtigkeit. Es wird zu Ballast, wenn man auf die longue durée
schaut.
In solchen Sätzen schimmert oft Demidows
eigenes Schicksal durch, als Häftling dessen, was der polnische Journalist Ryszard Kapuściński neben den Vernichtungslagern des Nationalsozialismus einmal “den
größten Albtraum des 20. Jahrhunderts” nannte. Demidow, geboren 1908 in Sankt Petersburg, gestorben 1987 in Kaluga, verbrachte 14 Jahre
in der Knochenmühle des Gulag-Arbeitslagers am Oberlauf des Kolyma im
russischen Fernen Osten. Hunderttausende Häftlinge mussten hier unter
bestialischen Bedingungen Gold und Metalle aus den Bergen kratzen.
Immer kleiden solche beiläufigen
Bemerkungen das dramatische Schicksal des Personals von Demidows Erzählungen
aus. Sie zeigen an, warum Menschen darin aufeinander zufahren wie unbeirrbare
Züge, aufs Gleis gesetzt von einer Vielzahl von Entscheidungen, die sich zu Kaskaden
von Macht verdichten. Und doch weitet Demidow auch den Blick für das soziale
und politische Leben in der UdSSR unter Stalin.
“Die Geschichte urteilt danach, ob man verloren hat”
Die Passage über das Gewissen findet
sich in Abschnitten einer berichtartigen Zusammenfassung des Lebensweges von
Andrej Januarjewitsch Wyschinski, der von 1935 bis 1939 sowjetischer
Generalstaatsanwalt war. Wyschinski wird in Zwei Staatsanwälte als wichtigster
Rechtstheoretiker der UdSSR vorgestellt, seinen handlungsleitenden Gedanken,
der ihm den Weg von den eher sozialdemokratischen Menschewiken zu den erheblich
brutaleren Bolschewiken möglich machte, fasst Demidow gelassen zusammen: “Die
Geschichte urteilt nicht nach Methoden und Zielen des politischen Spiels,
sondern danach, ob man es verloren hat.”
Die groben Striche, die den
Generalstaatsanwalt, seinen Lebensweg und seine Rechtstheorie
umreißen, fügen sich zu einem Porträt der Sowjetunion. Und es enthält auch eine
tödliche Warnung an einen anderen Staatsanwalt: Kornew, der gerade von der
juristischen Hochschule mit dem glühenden Wunsch nach Dienerschaft für den Sozialismus
graduiert wurde. Kaum aus der Uni, wird er in “eine Zeit tiefer
Stürze schwindelerregender Karrieren” gestoßen. Kornews erste Aufgabe ist
die Inspektion von Gefängnissen. Die werden im Großen Terror des Stalinismus gerade
mit angeblichen Konterrevolutionären gefüllt.
Kornew, dem Demidow nur den
Kosenamen Mischa gibt, ist ein sozialistischer Idealist und Protagonist der
Erzählung. Gleich wird er bei Wyschinski vorsprechen. Die kleine Warnung vorab
können wir dabei genauso übersehen, wie auch Kornew sie wohl übersieht: Demidow
stellt dessen felsenfeste Überzeugung, in der höchsten Strafverfolgungsbehörde
Möglichkeiten für eine Korrektur von Vergehen in der Provinz zu finden, mit
einem zarten Hinweis auf sandigen Grund: “Die Maschine der Obersten Staatsanwaltschaft
funktionierte präzise und reibungslos.”
Georgi Georgijewitsch Demidow wuchs in der
heutigen Ukraine auf, studierte Physik in Charkiw, meldete sein erstes Patent
mit 21 Jahren an, wurde schnell Assistenzprofessor an der Universität. Das
wissen wir aus einer kurzen Biografie, die seine Tochter Valentina Demidowa
zusammengetragen hat. In Charkiw forschte er an nuklearphysikalischen Fragen, erlebte
wohl “die glücklichste Zeit” seines Lebens, wie seine Tochter ihn
zitiert. Eines Tages aber wird er festgehalten, sein Pass soll überprüft werden.
Demidow gerät in ein Verfahren gegen Mitglieder seines Instituts, es ist Teil einer
orchestrierten Serienliquidation von Wissenschaftlern im Rahmen von Stalins
Säuberungen.
Das Gros der Häftlinge überlebte im
Kolyma-Lager zwei, vielleicht drei Jahre. Als Demidow etwa fünf Jahre
Zwangsarbeit durchstanden hatte, fand er einen Weg, um ein brennendes Problem
zu beheben. Seit Längerem ließen sich keine Glühbirnen mehr auftreiben, in Dutzenden Lagern, Minen und Fabriken waren Hunderte Lampen ausgefallen. Ihr
Vater, schreibt Valentina Demidowa, muss eine Form von Recycling und Reparatur
entwickelt haben, stand bald einer Brigade vor. Als Belohnung wurde ihm möglicherweise
die Freiheit versprochen, jedenfalls war ein Festakt geplant.






















