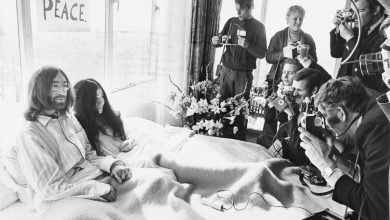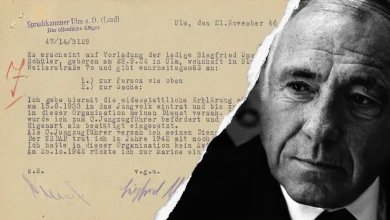Gemälde von Donald Trump: Er ist auferstanden | ABC-Z

Selbst wenn man sich kurzzeitig wie, sagen wir, Jesus fühlen
sollte, dann kann man sich immer noch aussuchen, wie man seine Gefühle genau ausleben
möchte. Das Neue Testament hält da ganz viele Rollen bereit. Albrecht Dürer
etwa malte sich in seinem Selbstbildnis im Pelzrock mit jesusartiger
Lockenpracht, und er schenkte dem Gottessohn großzügigerweise seine
persönlichen Gesichtszüge. Wenn der Mensch das Ebenbild Gottes ist und wir alle
Gottes Kinder sind, dann müsste doch, so dachte sich Albrecht Dürer frei nach
Adam Riese, Jesus eigentlich aussehen wie ich.
Wenn man nicht ganz so viel Selbstbewusstsein hat wie Dürer,
dann kann man die Sache auch mit sehr viel mehr Weltschmerz anpacken: Der
belgische Künstler James Ensor malte sich im späten 19. Jahrhundert auch
immer wieder als Christus – aber als den leidenden, der das Kreuz trägt, als
Schmerzensmann. Auch Paul Gauguin stellte sich selbst immer wieder als
leidenden Märtyrer dar in Posen, die wir aus der Passionsgeschichte kennen; der
sehr große, immer verzweifelte Egon Schiele zeigte sich selbst mit
ausgebreiteten Armen, manchmal sieht man sogar die Wundmale auf seinen Händen,
als hänge er gerade am Kreuz. Auch hier also überall eine Identifikation aus
Größenwahn, aber aus einem des Leidens.
Nun, im Jahre 2025 nach Christi Geburt ist eine neue Stufe
erreicht. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat im großen Foyer des
Weißen Hauses ein Gemälde aufhängen lassen, das ihn selbst in dem Moment zeigt,
nachdem er das Attentat auf sich am 13. Juli 2024 in Pennsylvania überlebt hatte.
Schon am Abend jenes Tages ahnte der New Yorker, dass es genau dazu kommen
würde: Dies sei das Motiv, “das Trump genau so einfängt, wie er gesehen werden
möchte, und zwar so perfekt, dass es alle anderen Bilder überdauern könnte“.
Nun hat es diesen Zustand der Ewigkeit erreicht, Öl
auf Leinwand, mitten im Weißen Haus. Stilistisch erinnert das Bild
lustigerweise an schwache Propagandakunst aus einer entlegenen Sowjetrepublik
der Siebzigerjahre. Das Foto basiert auf den ikonischen Fotografien, die Doug Mills und Evan Vucci in
den Sekunden nach dem Attentat geschossen haben. Im
Zentrum des Gemäldes steht der Präsident, dem die schmalen Blutrinnsale vom
Streifschuss am Ohr über die Backe laufen und der die Faust erhoben hat.
Unglücklicherweise hat der Künstler oder die Künstlerin, dessen
oder deren Identität das Weiße Haus noch nicht bekannt gegeben hat, der
Trumpschen Faust noch zwei weitere Hände an die Seite gemalt, deren zugehörige
Arme man schwer zuordnen kann: Sie irren durch den Bildraum. So hat das Ganze
eher den Charakter eines “Drei Fäuste für ein Halleluja”. Womit aufs Schönste
die erwünschte feierliche Heiligkeit des Bildes unterstrichen wird. Ein
“Hallejuja”, ein “Lobet den Herrn” wird hier nämlich gleich zweifach
angestimmt. Einerseits will Trump dem Herrgott danken, dass er ihn dieses
Attentat überleben ließ. Genau das tun auch die Republikanische Partei und die
evangelikale Kirche, die im Missglücken des Attentats einen deutlichen
Eingriff von ganz oben sehen.
Sein ganz persönlicher Karfreitag
Andererseits aber, und das ist das Dumme, sieht sich Trump
durch dieses Überleben selbst nun als Auserwählten, mindestens als Märtyrer,
wenn nicht gleich als Jesus selbst. Nun hat es ihm offenbar zeitlebens nie an
einem grotesken Selbstbewusstsein gemangelt: Die Pose auf seinen frühen goldenen
Porträts im Trump Tower ähnelt durchaus der von Dürers Selbstbildnis im
Pelzrock. Aber jetzt geht Trump noch weiter.
Wer außer Jesus und mir hat schon seinen eigenen Tod
überlebt, mag sich Donald Trump in einer seiner schlaflosen Nächte in Mar-a-Lago
gefragt haben, als er wahllos durchs Fernsehprogramm zappte. Gäbe es also ein
besseres, schlüssigeres Bild von ihm als jenes, das ihn nach seinem persönlichen
Karfreitag zeigt? Und so beauftragte er einen Künstler, jenen Moment zu malen,
in dem er selbst wiederauferstanden ist. Das ist die österliche Botschaft, die
dieses Jahr aus dem Weißen Haus in die Welt dringen soll. Die
Sicherheitsbeamtin zu Trumps Füßen wirkt auf dem Gemälde, als sei sie die
trauernde Mutter Maria, ja, alles soll aussehen wie ein Bild aus der
Renaissance oder wenigstens aus den Unabhängigkeitskriegen, schließlich schwebt
über allem die US-amerikanische Flagge. Nur die billige Sonnenbrille des Securitymannes
rechts holt das Bild unschön in die Gegenwart.
Am besten nähert man sich ihm auf Knien
Was mag Besuchern durch den Kopf gehen, die gleich einen
Termin bei Trump haben und dieses Gemälde passieren? Die Perspektive des Bildes,
also der Blick von ganz unten herauf zum Auferstandenen, dürfte ihnen auf jeden
Fall die Richtung vorgeben: Dem Dargestellten nähert man sich am besten auf Knien.
Jesus brauchte vor zwei Jahrtausenden noch Tage, bevor er nach
seinem Tod am Kreuz die schweren Steinplatten auf seinem Grab überwand.
Donald Trump stand schon 75 Sekunden nach dem Streifschuss am rechten Ohr
wieder auf. Das ist wahrscheinlich, was der Soziologe Hartmut Rosa damit
meinte, als er die “Beschleunigung” zum Phänomen unserer Epoche erklärt hat.
Es gibt nur ein kleines Problem der Trumpschen Jesusnachfolge: Wir wissen, dass
Trump in dem historischen Moment, den das Bild einfängt, sein längst ebenfalls historisches
“Fight, fight, fight!” in die Welt rief. Mit den Lehren der Bergpredigt Jesu ist
das nur schwer in Einklang zu bringen.