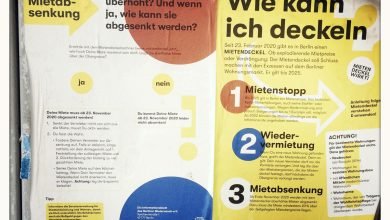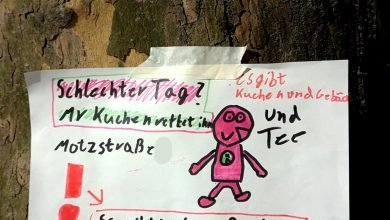Fünf Lehren aus den Stichwahlen in Brandenburger Städten | ABC-Z

Bürgermeisterwahlen
–
Fünf Lehren aus den Stichwahlen in Brandenburger Städten
Mo 13.10.25 | 18:27 Uhr | Von
Parteilose auf dem Vormarsch, die SPD im Krisenmodus und die AfD ohne Durchbruch – die Stichwahlen in Brandenburger Städten zeigen Trends. Überraschend hoch bleibt das Interesse an kommunaler Politik, analysiert Thomas Bittner.
1. Der Siegeszug der Parteilosen ist nicht unproblematisch
In den beiden kreisfreien Städten Potsdam und Frankfurt (Oder) haben sich eine Einzelbewerberin und ein Einzelbewerber durchgesetzt. Noosha Aubel, die zukünftige Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt, machte noch am Wahlabend klar, dass sie auch zukünftig in keine Partei eintreten werde. “Meine Partei heißt Potsdam” – so warb Noosha Aubel für sich. Dass hinter ihr auch Parteien wie die Grünen oder der Potsdamer BSW-Ableger BfW standen, konnte damit geschickt überspielt werden.
Axel Strasser in Frankfurt (Oder) hatte sich ganz ohne politisches Hinterland selbst aufs Schild gehoben. Parteilosigkeit wurde zum Gütesiegel bei dieser Wahl. Das Wahlvolk hat immer weniger Verständnis für das Agieren von Bundes- und Landespolitik. So erklärt sich, dass sich Kandidierende von den Parteien abkoppeln wollen. Politiker ohne Parteibuch gelten als unbefleckt und unabhängig. Doch das kann sich als Trugschluss herausstellen.
Rathauschefs müssen nämlich in zwei Richtungen agieren. In der Stadt müssen sie mit den Stadtverordneten, die teilweise unter ganz anderen politischen Vorzeichen gewählt wurden, nach Kompromissen suchen. Eine gemeinsame Basis muss erst gefunden werden. In der anderen Richtung – im Zusammenspiel mit der Landesebene – muss die Rathausspitze viel für die Kommune herausholen: Haushaltsgelder, Fördermittel, Landesinvestitionen. Ohne eine Anbindung an eine Landespartei, die Sitz und Stimme im Parlament hat, kann das mühsam werden.
Dass Engagement für eine Partei zum Makel bei Wahlen werden könnte, ist auch mit dem Blick aufs Grundgesetz ein ernsthaftes Problem. Schließlich hat die Verfassung gerade den politischen Parteien eine besondere Rolle bei der Willensbildung des Volkes zugesprochen. Deutschland hat derzeit ein sehr breites Parteienspektrum, da müssten sich durchaus viele Positionen auch auf kommunaler Ebene wiederfinden. Gerade in Städten und Gemeinden wird ganz praktisch Demokratie eingeübt. Wenn Parteien dort immer weniger eine Rolle spielen würden, wäre das fatal. Die Stichwahlen sollten ein Weckruf für sie sein.
2. Brandenburgs SPD hat ein riesiges Potsdam-Problem
Das Potsdamer Szenario war nicht neu: Nach der Abwahl eines Oberbürgermeisters musste die SPD ganz schnell einen neuen Personalvorschlag machen. Das war 1998 schon einmal so. Nachdem Horst Gramlich als SPD-Oberbürgermeister von den Bürgern abgewählt wurde, mussten die Sozialdemokraten eine überzeugende Alternative anbieten. Ministerpräsident Manfred Stolpe gab seinerzeit seinen Umweltminister für die Aufgabe frei. Der gebürtige Potsdamer Matthias Platzeck gewann gleich im ersten Wahlgang und sorgte für bessere Stimmung in der Landeshauptstadt. Und heute?
Die SPD agierte selten so glücklos wie jetzt in Potsdam. Erst beteiligten sich auch Sozialdemokraten an der Demontage des SPD-Oberbürgermeisters Mike Schubert, dann ließ man sich vom klaren Abwahlvotum überraschen. Kein prominenter Potsdamer Sozialdemokrat ließ sich auf das Wagnis einer Kandidatur ein. Die SPD-Landesspitze in Person des Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Dietmar Woidke brachte sich nicht wirklich ein. Ein Berliner Sozialdemokrat aus dem Umfeld von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sollte es richten. Was für ein Armutszeugnis für die Potsdamer SPD!
Severin Fischer lernte die Stadt, die er regieren wollte, erst durch den Wahlkampf kennen. Bezeichnend ist, dass am Wahlabend bei der SPD-Wahlparty in der Potsdamer Landeszentrale zwar Franziska Giffey aus Berlin angereist war, nicht aber Dietmar Woidke aus Forst.
Vor der Stichwahl stellten sich ausgerechnet die früheren Oberbürgermeister Matthias Platzeck und Jann Jakobs in einem “Bürgerbrief” gegen “grüne Experimente” und soziale Ungerechtigkeiten im Programm der gegnerischen Favoritin. Das wurde als Diffamierung wahrgenommen.
Am Ende stand SPD-Kandidat Fischer mit der Unterstützung der FDP und einiger Linker ziemlich allein da. Zu viele handwerkliche Fehler, zu viel Ignoranz, zu wenig Profil. Die SPD hat ihre Potsdamer Spitzenposition fahrlässig preisgegeben. Vor einem Jahr hatte sie in Potsdam noch die Kommunalwahl gewonnen.
3. Die “blaue Welle” der AfD blieb bisher aus
“Die AfD bringt Realismus ins Rathaus”, versprach der AfD-Landesvorsitzende René Springer. Er wetterte gegen Ideologie, Wahnsinn und Gängelung. Doch bisher hat sich das Wahlvolk in den Städten nicht auf den Realismus der AfD einlassen wollen. Die Rechtspartei hat sich zum Ziel gesetzt, bald Brandenburg zu regieren. Und zwar allein, denn Bündnispartner hat sie für ihren scharf rechten Kurs bisher nicht finden können. Die Bürgermeisterwahlen sollten ein Testballon für die Akzeptanz ihrer Kandidaten sein.
Die AfD braucht schließlich hauptamtliche Amtsträger in Rathäusern, um ihren Marsch durch die Institutionen an die Macht zu starten. In vielen Kommunen ist die AfD bereits die stärkste Kraft in Stadtverordnetenversammlungen oder Kreistagen. Doch die relative Mehrheit, die dafür ausreicht, die stärkste Fraktion im Stadtparlament zu stellen oder sogar ein Direktmandat im Bundestag oder Landtag zu gewinnen, ist eben noch lange nicht die Mehrheit aller Wählerinnen und Wähler. Für viele war der Impuls, einen AfD-Bürgermeister zu verhindern, der eigentliche Grund für den Wahlsieg des Gegenkandidaten. Weder in Frankfurt (Oder) noch in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) oder Wriezen (Märkisch-Oderland) konnten die AfD-Kandidaten im Vergleich zum ersten Wahlgang bei der Stichwahl signifikant zulegen.
Bei allem Frust und Zorn, die Stadtgesellschaften wollten bisher mehrheitlich nicht, dass eine Partei das Rathaus führt, die gegen alle anderen wettert, Rechte von Minderheiten einschränken will oder ganz offen “Remigration” von Zugewanderten propagiert. Noch macht sich die Landespartei Hoffnung auf den Einzug in die Rathäuser von Oranienburg (Oberhavel) oder Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) am kommenden Wochenende. Aber die erwartete “blaue Welle” ist bisher ausgeblieben.
4. Die CDU ist nicht die konservative Alternative zur Alternative
Die Christdemokraten haben sich in der Vergangenheit stets als Kommunalpartei verstanden. Sie stellten oder stellen auch Oberbürgermeister in Frankfurt (Oder), Cottbus und Brandenburg an der Havel. Diesmal schafften es Christdemokraten aber nicht mal in die Stichwahl der kreisfreien Städte. Ja, es ist gelungen, auch CDU-Bürgermeister in die Rathäuser zu bekommen. Aber nicht als überzeugende Alternative zum Siegeszug der Parteilosen oder zum Aufstieg der AfD.
In Prenzlau (Uckermark) stellte sich CDU-Mann Marek Wöller-Beetz vorsichtshalber als Einzelbewerber auf, in Elsterwerda (Elbe-Elster) kündigte Bürgermeisterin Anja Heinrich am Tag nach der Wiederwahl ihren CDU-Austritt an. In Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) entschieden gerade mal 42 Stimmen mehr für den CDU-Kandidaten Arno Steguweit.
Das sind nicht unbedingt klare Zeichen, dass der Kurs der Merz-Partei auch in den Kommunen für einen Stimmungswandel sorgt. Lediglich in Wriezen schaffte es der amtierende CDU-Bürgermeister Karsten Ilm, den AfD-Gegenkandidaten klar zu distanzieren. Gute Arbeit im Amt scheint noch immer das beste Rezept für einen Wahlsieg zu sein.
5. Brandenburgerinnen und Brandenburger sind nicht politikmüde
Bei Kommunalwahlen ist die Beteiligung oft ein Problem. Schon mehrfach mussten die Wahlen von Landräten an die Kreistage gegeben werden, weil am Wahltag das Quorum nicht erreicht wurde. Die Wahlbeteiligung bei kommunalen Wahlen blieb stets unter der Beteiligung an Landtags- oder Bundestagswahlen.
Man hätte annehmen können, dass in diesem Jahr nach Landtags- und vorgezogener Bundestagswahl eine allgemeine Wahlmüdigkeit für schlechte Beteiligungsquoten sorgt. Doch das Interesse an der Wahl der Stadtoberhäupter war in diesen Wochen hoch. Die Wählerforen waren gut besucht.
Und selbst bei den Stichwahlen sind die nötigen Quoren in den Städten mühelos erreicht worden. In kleineren Städten war die Wahlbeteiligung sogar größer als in den kreisfreien. Während in Hennigsdorf (Oberhavel) oder Potsdam etwas mehr als 40 Prozent zur Stichwahl gingen, waren es in Wriezen fast 52 Prozent der Wahlberechtigten, die an einem trüben Herbstsonntag zum zweiten Mal in die Wahllokale zur Stimmabgabe zogen.
Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 13.10.2025, 19:30 Uhr