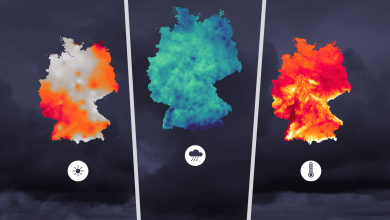Frankfurt: Vorkaufsrechte führen zu Wohnungsleerstand | ABC-Z

Das Haus an der Hersfelder Straße in der Nähe des Frankfurter Westbahnhofs sieht auf den ersten Blick ganz ordentlich aus. Es dürfte in den Fünfzigerjahren gebaut worden sein, der rote Anstrich an der Fassade ist aber jüngeren Datums. Ausweislich des Klingelbretts befinden sich in den vier Geschossen fünf Wohnungen. Betreten hat das Haus aber offensichtlich schon lange niemand mehr. Vor der Eingangstür liegt ein Berg von Werbeprospekten und Anzeigenblättern, die Briefkästen sind nicht geleert. Die Fenster der Wohnungen sind von innen mit Folie zugeklebt.
Wie lange und warum das Haus schon nicht mehr bewohnt wird, ist nicht bekannt. Fest steht nur: Die Stadt hat es 2019 über ein Vorkaufsrecht erworben, 870.000 Euro sind damals nach Informationen der F.A.Z. geflossen. Zwischen 2017 und 2021 hat die Stadt neun Objekte in sogenannten Milieuschutzgebieten gekauft. Es handelt sich um Mietshäuser, bei denen die Stadt vermutete, dass der neue Eigentümer umfangreiche Modernisierungen planen und damit die Mieter verdrängen könnte. Das würde dem Ziel widersprechen, in sozialen Erhaltungsgebieten die Zusammensetzung der Bevölkerung zu schützen. Oft müssen die Häuser dringend saniert werden – doch für eine schnelle Instandsetzung fehlt bei der Stadtverwaltung das Personal.
Seit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem November 2021 können Vorkaufsrechte in dieser Form nicht mehr ausgeübt werden. Der Deutsche Städtetag fordert deshalb eine neue gesetzliche Grundlage. „Die Städte müssen endlich wieder handlungsfähig werden und Vorkaufsrechte umfassend und auch in sozialen Erhaltungsgebieten anwenden dürfen“, sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Städtetags, im vergangenen Jahr.
Keine Vereinbarung mit Hausbesetzern
Die künftige Koalition aus CDU/CSU und SPD im Bundestag will diesen Wunsch jetzt erfüllen. Das Vorkaufsrecht der Kommunen in Milieuschutzgebieten solle gestärkt werden, heißt es im Koalitionsvertrag. Auch „Schrottimmobilien“ sollen Städte künftig kaufen dürfen, um nachteilige Auswirkungen auf die Umgebung zu vermeiden. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, den Kaufpreis auf den amtlichen Verkehrswert zu begrenzen. Gregor Weil, Geschäftsführer des Eigentümerverbands Haus & Grund Frankfurt, spricht deshalb von Plänen, die auf eine Enteignung hinausliefen.
Zumindest in Frankfurt gelingt es der Stadt nicht, nachteilige Auswirkungen durch den Kauf von Häusern zu vermeiden. Bekanntes Beispiel ist ein Haus an der Jordanstraße im Stadtteil Bockenheim, das die Stadt 2017 erworben hat. Jahrelang stand die ehemalige Gaststätte „Pielok“ im Erdgeschoss leer, das Gebäude verkam zusehends. Ende 2023 wurde es besetzt. Seitdem wird dort nach Darstellung der Besetzer ein „selbstorganisiertes Stadtteilcafé“ betrieben. Die von Baudezernentin Sylvia Weber (SPD) angekündigte Nutzungsvereinbarung gibt es immer noch nicht.
Der CDU-Stadtverordnete Thomas Dürbeck hat sich die über Vorkaufsrechte erworbenen Immobilien der Stadt genauer angeschaut – und zeigt sich erschüttert. Viele seien in einem schlechten Zustand, es gebe offensichtlichen Leerstand. Als Beispiel nennt er ein Haus an der Wittelsbacherallee im Ostend: Dort hängt offensichtlich schon seit Längerem ein notdürftig mit Klebestreifen befestigtes Schreiben der Netzdienste Rhein-Main an der Tür, in der die Bewohner aufgefordert werden, sich zu melden, weil die Sicherheit der Gasanschlüsse überprüft werden müsse. In einem Haus an der Münsterer Straße im Gallus würden seit Jahren keine Reparaturen mehr ausgeführt, sagt Dürbeck. „Ein Privater dürfte sich so etwas nicht erlauben.“
CDU kritisiert Geheimhaltung
Bei seinen Recherchen hat der CDU-Politiker Ungereimtheiten entdeckt. Einige Käufe habe das Stadtparlament nachträglich über nichtöffentliche Beschlussvorlagen genehmigt, andere nicht. Wie viele Wohnungen die Stadt insgesamt zu welchem Preis erworben habe, sei nicht bekannt. Die CDU-Fraktion fordert deshalb in einem Antrag, der in der nächsten Planungsausschusssitzung des Stadtparlaments behandelt wird, die Vorlagen öffentlich zu machen. Es bestehe kein Grund zur Geheimhaltung mehr.
Die von der Stadt aufgewendete Gesamtsumme lässt sich nur indirekt ermitteln: Dürbeck kommt anhand der zwischen 2019 und 2021 beschlossenen vertraulichen Vorlagen auf 17,4 Millionen Euro. Aus einer älteren Äußerung von Baudezernentin Weber geht hervor, dass 2017 drei Häuser für zusammen rund sieben Millionen Euro erworben wurden. Insgesamt dürfte die Stadt für die Ausübung von Vorkaufsrechten also fast 25 Millionen Euro ausgegeben haben.
Zumindest ein Teil des Geldes wird in die Stadtkasse zurückfließen. Denn die Stadt darf die Immobilien nicht auf Dauer behalten, sondern ist verpflichtet, sie wieder zu privatisieren. Der Magistrat hat 2023 angekündigt, dieser Pflicht nachzukommen und die Immobilien in Form von Erbbaurechten zu vergeben. Passiert ist bisher allerdings nichts. Offen ist, wer sich für die Häuser interessieren könnte. Frank Junker, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft ABG, hat wegen des großen Sanierungsbedarfs bereits abgelehnt.