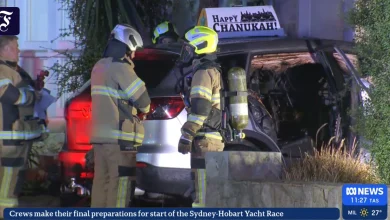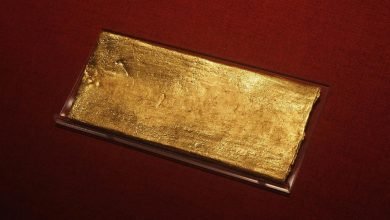Frankfurt: Fernsehturm soll wieder öffentlich zugänglich gemacht werden | ABC-Z

Wer zu Fuß gehen will, braucht eine gute Kondition. Rund 1000 Stufen müssen genommen werden, um im Treppenhaus bis zur Aussichtsplattform des Frankfurter Fernsehturms in 222 Meter Höhe zu gelangen. Den Ausblick, der sich dort oben auf die Skyline und den Taunus bietet, können allerdings nur wenige genießen. Seit 25 Jahren ist die Kanzel, in der sich einst ein Restaurant und eine Diskothek befanden, aus Brandschutzgründen für die Öffentlichkeit geschlossen.
Schon seit mehreren Jahren gibt es Überlegungen, den 337 Meter hohen „Ginnheimer Spargel“, wie er in Frankfurt liebevoll genannt wird, wieder zugänglich zu machen. 2019 ließ die Eigentümerin, die Telekom-Tochtergesellschaft Deutsche Funkturm, eine Machbarkeitsstudie erstellen mit dem Ziel, die Restaurantebene und das Aussichtsgeschoss in ihrer ursprünglichen Funktion wiederherzustellen. Maximal 900 Personen sollen sich auf den verschiedenen Ebenen der Kanzel aufhalten können. Das wären deutlich mehr als in den Neunzigerjahren, als der Turm für maximal 550 Personen in Restaurant und Diskothek ausgelegt war.
Der Investitionsbedarf wurde in der Studie auf rund 50 Millionen Euro geschätzt. Unter anderem müsste ein Feuerwehraufzug eingebaut werden, auch ein neues Eingangsbauwerk war vorgesehen. Die Pläne sind im Sande verlaufen – obwohl der Bundestag in Aussicht gestellt hatte, die Hälfte der Kosten zu übernehmen, wenn auch Land und Stadt sich beteiligen. Erst im Sommer teilte der Frankfurter Magistrat mit, dass es kein „unmittelbar umsetzbares Konzept für eine Wiedereröffnung“ gebe. Jetzt drohen die Fördermittel zu verfallen. „Dies würden wir sehr bedauern“, teilte die Deutsche Funkturm auf Anfrage mit.
Einnahmen generieren
Der Frankfurter Unternehmer Peter Pawelski will sich damit nicht abfinden. Er hat eine Idee entwickelt, wie eine Belebung des auch Europaturm genannten Bauwerks privatwirtschaftlich ermöglicht werden könnte. Er stellt sich vor, den Fernsehturm zu einem „Reallabor der digitalen Entwicklung“ zu machen. Tech-Unternehmen, Banken, Bauhandwerk und Forschungseinrichtungen sollen dort gemeinsam unter realen Bedingungen neue Lösungen für Mobilität, Energieeffizienz, Klimaschutz, Bildung und digitale Dienstleistungen entwickeln – und auf diese Weise Einnahmen generieren, mit denen sich die Investitionen in Millionenhöhe refinanzieren lassen.
Nächste Woche will Pawelski die mit mehreren Partner entwickelte Idee beim „Great Work Festival“ vorstellen, das sein im Frankfurter Tech-Quartier an der Messe angesiedeltes Unternehmen CNTXT8 im „Circle Cube“ am Offenbacher Hafen organisiert. Als Gastredner sind unter anderen Leopold Born, Generalsekretär der hessischen CDU, und der Wirtschaftswissenschaftler Stephan Jansen angekündigt.
Der Schwerpunkt von Pawelskis Konzept liegt auf Technologie und neuartigen Finanzdienstleistungen. Es geht, vereinfacht gesagt, darum, das Thema Datenaustausch, für das der Europaturm seit jeher steht, für neue Anwendungen der „Smart City“ nutzbar zu machen. Die Konstruktion eines „Reallabors“ – die gesetzliche Grundlage dafür wird gerade im Bundestag beraten – soll es ermöglichen, unter realen Bedingungen Innovationen auszuprobieren, die sonst an die Grenzen des Rechtsrahmens stoßen würden. „Wir wollen zeigen, dass Wirtschaft, neue Technologie, Architektur und Gemeinschaft zusammengehören“, sagt Pawelski. „Der Europaturm kann zu einem sichtbaren Symbol für Erneuerung und Partizipation werden.“
KI soll helfen
Der seit 2019 unter Denkmalschutz stehende Turm solle ein „kulturell wertvoller Begegnungsort“ werden, heißt in dem Konzept. Auf 75 Millionen Euro schätzt Pawelski den Investitionsbedarf für die Ertüchtigung, einschließlich Innenausbau. Zusätzlich könnte rund um den Turm ein „grünes Quartier“ entstehen. Zur Finanzierung will er digitale Token ausgeben. Das sind virtuelle Anteilscheine, die in einer Blockchain gespeichert werden, also in einer dezentralen, fälschungssicheren Datenbank. Auf diese Weise kann vergleichsweise einfach Geld von einer großen Zahl an Investoren gesammelt werden. Im Konzept ist von „genossenschaftlichem Denken“ die Rede.
Die Rendite für die Investition – angestrebt werden sechs Prozent – soll über innovative Mobilitätslösungen erwirtschaftet werden. Künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge, Sensoren und Datenplattformen sollen helfen, zum Beispiel das Parkraummanagement neu zu organisieren. Als Anwendungsfall kann sich Pawelski die Situation rund um das Waldstadion vorstellen, die sich durch den geplanten Bau einer Multifunktionsarena noch einmal verschärfen wird. „Wir wollen den Zweck und Wert neuer Technik erlebbar machen“, sagt Taia Güllich, Kommunikationsmanagerin beim Unternehmen CNTXT8, das erst vor wenigen Monaten als Strategieplattform für Bauwirtschaft und Immobilien gegründet worden ist.
Die Deutsche Funkturm kennt das Konzept nach eigenen Angaben bisher nicht. Doch Pawelski hat schon einen Zeitplan: Von Juli 2026 an könnte das Vorhaben realisiert werden – und 2031 könnte das Reallabor in Betrieb gehen und der Turm wieder öffentlich zugänglich sein. Bis es so weit ist, müssen noch viele Stufen erklommen werden.