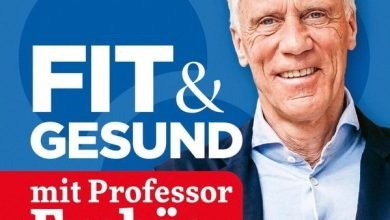Forscher warnen vor den Folgen verbaler Angriffe | ABC-Z

Berlin. Gewalt muss nicht körperlich sein. Neue Studien zeigen: Abwertende Worte in der Kindheit erhöhen das Risiko für psychische Störungen.
Die Ohrfeige hat keinen Platz mehr im Klassenzimmer – darin sind sich heute die meisten einig. Doch wie steht es um jene Form von Gewalt, die keine blauen Flecken hinterlässt, aber oft tiefer trifft? Beschimpfungen, Drohungen, ständige Herabwürdigungen: Verbale Gewalt gehört für viele Kinder noch immer zum Alltag. Und sie bleibt häufig unbeachtet– weil sie leise ist, weil sie alltäglich wirkt, weil sie oft nicht als das erkannt wird, was sie ist: eine Form der Misshandlung.
Nun zeigt eine groß angelegte Studie aus England und Wales, wie gravierend die Folgen sein können. Die Daten deuten darauf hin, dass Kinder, die regelmäßig verbaler Gewalt ausgesetzt waren, im späteren Leben ein ähnlich hohes Risiko für psychische Störungen tragen wie jene, die körperlich misshandelt wurden. Die Ergebnisse stellen eine unbequeme Frage in den Raum: Wie gefährlich ist der Ton, den wir gegenüber Kindern für normal halten – und was richtet er an?
Körperliche Gewalt: Ein überholter Erziehungsstil mit langer Wirkung
Noch vor wenigen Jahrzehnten galt körperliche Züchtigung als gängige Erziehungsmethode – auch in Deutschland. Zwar hat inzwischen ein kultureller Wandel eingesetzt, doch tief verwurzelte Haltungen halten sich hartnäckig.
So zeigte eine repräsentative Umfrage der Universitätsklinik Ulm im Jahr 2020: Mehr als die Hälfte der Befragten (52,4 Prozent) stimmten der Aussage zu, ein „Klaps auf den Hintern“ habe „noch niemandem geschadet“. 23,1 Prozent hielten Ohrfeigen für vertretbar, 7,2 Prozent sogar eine „Tracht Prügel“.
Auch international sind Misshandlungs-Erfahrungen keine Seltenheit. In den USA gaben laut der Youth Risk Behavior Survey der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mehr als 60 Prozent der Jugendlichen an, emotionale Gewalt durch Eltern oder Erziehende erlebt zu haben. Knapp ein Drittel (31,8 Prozent) berichtete von körperlicher Misshandlung.
Die aktuelle Studie, veröffentlicht im Fachjournal „BMJ Open“, zeichnet ein ähnliches Bild – mit einer wichtigen Entwicklung: Körperliche Gewalt nimmt ab, verbale Misshandlung hingegen zu. In England und Wales sank der Anteil der körperlich misshandelten Personen von rund 20 Prozent bei den Jahrgängen 1950 bis 1979 auf etwa 10 Prozent bei den nach 2000 Geborenen. Verbale Gewalt hingegen sei heute weiter verbreitet als noch vor wenigen Jahrzehnten.
Neue Studie zeigt: Verbale Gewalt in der Kindheit erhöht Risiko für psychische Erkrankungen
Das britische Forschungsteam richtete den Blick daher gezielt auf die verbale Komponente von Gewalt – und untersuchte, wie sich verbale Misshandlung im Vergleich zu körperlicher Gewalt in der Kindheit langfristig auf die psychische Gesundheit im Erwachsenenalter auswirkt. Dazu analysierten sie die Daten von über 20.000 Erwachsenen, die im Rahmen von sieben Langzeitstudien in England und Wales erhoben wurden. Die Kindheitserfahrungen wurden mit dem international etablierten Adverse Childhood Experiences Tool (ACE) erfasst, während das seelische Wohlbefinden im Erwachsenenalter mithilfe der Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale bewertet wurde.
Das Ergebnis ist eindeutig – und alarmierend: Menschen, die in ihrer Kindheit körperliche Gewalt erlebt hatten, wiesen im späteren Leben ein um 50 Prozent erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen auf. Bei Personen, die verbal misshandelt wurden, war dieses Risiko sogar um 60 Prozent erhöht.
„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass verbale Gewalt in der Kindheit ebenso tiefe und lang anhaltende psychische Spuren hinterlassen kann wie körperliche Gewalt“, sagt Studienleiter Dr. Mark Bellis, Professor für öffentliche Gesundheit an der Liverpool John Moores University.
Lesen Sie auch: Heikos Ehefrau misshandelte ihn – bis ein Anruf ihn rettete
Was ist verbale Gewalt gegen Kinder? Mehr als nur harsche Worte
Die Zahlen sind eindeutig – doch was genau zählt eigentlich als verbale Gewalt? Viele Eltern und Bezugspersonen tun sich schwer, eine klare Grenze zu ziehen: Wo endet eine strenge Erziehung, wo beginnt Misshandlung? „Es kann schwierig sein, eine klare Grenze zu ziehen zwischen harter Sprache und verbaler Gewalt“, erklärt Dr. Andrea Danese, Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie am King’s College London, im Gespräch mit dem US-Nachrichtensender „CNN“. Laut ihm gehören zu den typischen Formen verbaler Misshandlung unter anderem:
- Schuldzuweisungen
- Beleidigungen
- Übermäßige Kritik
- Schimpfen und Drohungen
Auch das wiederholte Verwenden abwertender Begriffe oder das Einschüchtern eines Kindes zählt dazu. „Denken Sie an die Verwendung abwertender Begriffe oder Äußerungen, die darauf abzielen, eine Person zu erschrecken, zu demütigen, zu verunglimpfen oder herabzuwürdigen“, so Danese weiter. „Oft geschieht dies unbeabsichtigt.“
Auch interessant: Toxische Eltern: Wenn Kindern nur noch der Kontaktabbruch bleibt
Gerade diese Unschärfe macht die verbale Gewalt so gefährlich – sie ist alltäglich, subtil und oft gut gemeint. Doch ihre Wirkung kann tiefgreifend sein: Sie verändert, wie Kinder sich selbst sehen – und wie sie die Welt wahrnehmen.
„Verbaler Missbrauch kann das Selbstverständnis eines jungen Menschen und seine Rolle in der Welt verzerren“,warnt Danese. Kinder seien in ihrer Entwicklung darauf angewiesen, die Sprache der Erwachsenen in ihrer Umgebung als Leitplanke zu nutzen. Wird diese Sprache abwertend, harsch oder verletzend, verliert das Kind die Orientierung.
Auch Studienleiter Dr. Mark Bellis betont: „Verbale Gewalt könnte die positiven Effekte auf die psychische Gesundheit zunichtemachen, die wir eigentlich durch den Rückgang körperlicher Gewalt erwarten.“ Oder anders gesagt: Was auf der einen Seite abnimmt, wird auf der anderen Seite – oft unbemerkt – zum ernsten Problem.
Langzeitfolgen verbaler Misshandlung: Depressionen, Angststörungen, chronischer Stress
Die langfristigen Folgen emotionaler Gewalt sind in der Forschung mittlerweile gut belegt. Zahlreiche Studien zeigen: Wer als Kind regelmäßig verbalen Angriffen ausgesetzt war, berichtet im Erwachsenenalter häufiger von Depressionen, Angststörungen, niedrigem Selbstwertgefühl und anhaltendem Stress.
Auch die aktuelle Studie reiht sich in diesen Forschungsstand ein – mit einer Besonderheit: Die Datenbasis ist ungewöhnlich groß und breit angelegt, was die Aussagekraft zusätzlich stärkt. Dennoch mahnen die Forschenden zur vorsichtigen Interpretation.
„Die Studie stützt sich auf Beobachtungsdaten“, erklärt Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Andrea Danese. „Das bedeutet, dass die Forscher nicht mit Sicherheit sagen können, dass verbale Gewalt in der Kindheit zu einer schlechteren psychischen Gesundheit im Erwachsenenalter führt – sondern nur, dass ein Zusammenhang besteht.“
Möglich sei auch, dass Menschen mit psychischen Belastungen rückblickend stärker negativ über ihre Kindheit berichten. Doch die Stärke und Konsistenz der Daten legen nahe, dass hier tatsächlich ein ursächlicher Zusammenhang besteht.
Das könnte Sie auch interessieren: Gewalt in der Familie: Wenn Kinder ihre Eltern misshandeln
Bewusst sprechen: Warum Sprache über seelische Gesundheit mitentscheidet
Was also tun mit diesem Wissen? Für die Forschenden ist klar: Wer Kinder schützen will, muss Sprache ernster nehmen – und bewusster mit ihr umgehen. „Es wird immer wichtiger, dass sowohl Einzelpersonen als auch die Forschung auf die Faktoren achten, die sich langfristig auf die psychische Gesundheit auswirken“, betont Studienleiter Dr. Mark Bellis.
Vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen wachse die psychische Belastung weltweit. Prävention müsse früher ansetzen – dort, wo Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Nähe, Vertrauen und Kommunikation machen: zu Hause. „Die Verbesserung des Umfelds in der Kindheit kann das psychische Wohlbefinden direkt stärken – und langfristig Resilienz fördern“, erklärt Bellis.
Zentral sei dabei, Eltern und Betreuungspersonen zu befähigen, betont er: mit Wissen, mit Unterstützung, mit positiven Vorbildern. „Das bedeutet, Eltern und Kindern zu helfen, emotionale Kompetenzen zu entwickeln – also Gefühle zu regulieren, Bindung zu stärken, besser zu kommunizieren und einen konstruktiven Umgang mit Konflikten zu erlernen.“
Auch Dr. Andrea Danese spricht sich gegen Schuldzuweisungen aus – und für einen kulturellen Wandel. „Die Lösung besteht nicht darin, Erwachsene zu beschämen“, sagt er. „Stattdessen versuchen wir, ein neues Bewusstsein zu fördern: einen achtsameren Umgang mit Sprache – und ein Verständnis dafür, wie stark Worte auf Kinder wirken können.“
Anmerkung der Redaktion
Von (häuslicher) Gewalt betroffene Personen können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. Das Opfer-Telefon des Weißen Rings ist unter 116 006 erreichbar. Opfer und Zeugen von häuslichen Gewalttaten können – bei Tag und Nacht – über den Notruf 110 Hilfe holen.
Frauen erhalten zude, Unterstützung beim bundesweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ der Bundesregierung unter der 116 016. Der Anruf ist kostenlos und auf Wunsch anonym. Über die Internetseite www.hilfetelefon.de können sich Betroffene zudem online per E-Mail oder Chat beraten lassen.
Das Männerhilfetelefon ist unter der bundesweiten Telefonnummer 0800 123 99 00 zu erreichen. Hilfe erhalten Betroffene auch im Internet auf der Seite der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz.
Kinderschutz beginnt bei der Sprache
Die Ergebnisse der Studie bestätigen, was Fachleute aus Psychologie und Pädagogik seit Jahren sagen: Nicht nur körperliche Gewalt verletzt – auch Worte können Wunden hinterlassen. Es sind seelische Narben, die oft unsichtbar bleiben, aber ein Leben lang nachwirken.
Ein FUNKE Liebe
Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der
Werbevereinbarung
zu.
In einer Gesellschaft, die körperliche Züchtigung zunehmend ablehnt, darf die emotionale Gewalt nicht länger übersehen werden. Denn Misshandlung beginnt nicht erst mit einer erhobenen Hand – sie beginnt mit dem Ton, den Erwachsene gegenüber Kindern anschlagen.