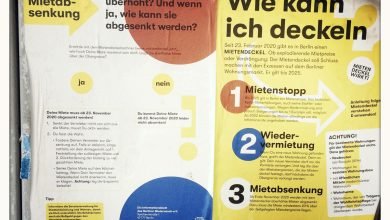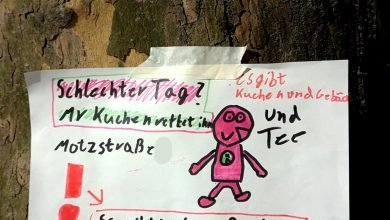Polizeiausbilder im Interview: “Mir kommt es so vor, als zückt man heute deutlich schneller ein Messer” | ABC-Z

Polizeiausbilder im Interview
–
“Mir kommt es so vor, als zückt man heute deutlich schneller ein Messer”
Messerangriffe haben in Berlin zugenommen – zumindest geben das die Zahlen der Berliner Polizei her. Ex-Polizist und Ausbilder Marcel Kuhlmey sieht die Ursache in fehlender Konfliktkompetenz junger Männer. Vergleiche mit früher hält er für schwierig.
rbb|24: Herr Kuhlmey, Sie bilden Polizisten an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin aus. In den 1980er und 1990er Jahren waren Sie selbst Polizist: Spielte das Thema Messergewalt damals eine so große Rolle wie heute?
Marcel Kuhlmey: Mir kommt es so vor, als zückt man heute deutlich schneller ein Messer. Früher, als ich noch Polizist war, erlebte ich wie in Konfliktsituationen eher zu den Fäusten gegriffen wurde. Sicherlich war der Respekt zumindest vor Menschen in Uniform damals aber auch größer. Ich bin in meiner Zeit als Polizist niemandem auf der Straße begegnet, der ein Messer zog.
Jüngst gab es häufiger Berichte in Zusammenhang mit Messerangriffen. Vor kurzem erlag ein 20-Jähriger nach einer Auseinandersetzung am Humboldt-Forum seinen Stichverletzungen. Auch statistisch hat sich etwas getan: 2024 zählte die Polizei Berlin rund 3.400 Fälle von Messergewalt – 2015 waren es 2.600. Das ist ein deutlicher Anstieg, oder?
Ich denke schon, dass diese Zahlen insgesamt einen Anstieg zeigen. Ich muss aber auch sagen, dass die Kriminalitätsstatistik schwer einzuordnen ist. Es bedarf hier einer differenzierten Betrachtung. Wir dürfen nicht vergessen, dass zum Beispiel das Anzeigeverhalten hierbei eine Rolle spielt.
Diese Zahlen sagen auch nicht, dass jedes Mal ein Messer gezogen und zum Angriff ausgeholt wurde, was eine gefährliche Körperverletzung oder sogar einen Tötungsdelikt zur Folge hätte. Meistens wird gemeldet, dass eine Person ein Messer dabei hat – gut möglich, dass sie dann auch schon wieder weg ist, wenn die Polizei dazukommt. Die Zahlen sind also nur ein Indiz und die Medienberichte verstärken das Gefühl, dass es extrem geworden ist. Übrigens werden Messerangriffe noch nicht so lange als eigene Tatkategorie erhoben, auch deshalb sind Vergleiche mit früher schwierig.
Die Faustregel ist: Wer ein Messer mit sich führt, wird es eher einsetzen als jemand, der keins mit sich führt.
Das stimmt. Deshalb setzt die Polizei bei der Präventionsarbeit darauf, junge Menschen zu sensibilisieren. Sie sollen lernen, erst gar kein Messer mitzunehmen. Das reduziert die Verfügbarkeit und das Risiko von Eskalationen insgesamt. Natürlich gibt es noch Faktoren wie Alkohol und Partys, die eine Rolle spielen.
Die Polizei Berlin will mit dem Programm “Messer Machen Mörder” [berlin.de/polizei] Jugendliche in Schulen sensibilisieren. Die Lehrer müssen dafür aber selbst aktiv werden, um ein Team der Präventionsarbeit zu kontaktieren. Nicht ohne mit Blick auf Berlins volle Klassen und die ohnehin hohe Arbeitsbelastung für Lehrer, oder?
Die Schulen sind schon der richtige Ort für Präventionsprogramme. Die Polizei ist dort auch, wenn es um Themen wie Drogen und andere Gewaltdelikte geht. Aber Sie haben recht: Lehrer können das fachlich und zeitlich allein kaum leisten, daher muss die Polizei das übernehmen. Aber auch sie hat begrenzte Kapazitäten. Das Problem ist also auf beiden Seiten da.
Ist das Hauptproblem die Tatwaffe selbst oder die Sozialisierung von Tätern?
Es ist ein Konfliktlösungsproblem. Die Verfügbarkeit der Waffe selbst ist das eine, die fehlende Konfliktkompetenz und das impulsive Verhalten das andere. Messergewalt ist auch kein spezifisches Großstadtphänomen, sondern ein entwicklungsbedingtes Problem. Da gehören bestimmte Männlichkeitsnormen dazu, die Gewalt als legitim darstellen. Die Täter- und Opfer sind überwiegend männlich, meistens unter 25 Jahre alt.
Welche Maßnahmen reduzieren nachweisbar Messergewalt?
Eine Prävention, die früh ansetzt, und soziale Faktoren wie Ungleichheit oder fehlende Freizeitangebote adressiert. In Glasgow zum Beispiel werden Sport- und Freizeitangebote genutzt, um Gewaltbereitschaft langfristig zu reduzieren. In Deutschland ist das anders: Hier liegt der Fokus auf Waffen- und Messerverbotszonen, deren Effekt wissenschaftlich schwer zu belegen ist. Die Videoüberwachung von Orten wird nicht flächendeckend eingesetzt.
Durch Messerverbotszonen kann die Polizei Berlin unabhängig von konkreten Verdachtsmomenten Kontrollen durchführen. Diese in der Stadt eingeführten Zonen sind bis heute aber nicht richtig evaluiert.
Das stimmt, es gibt sie aber auch noch nicht so lange. Erfahrungen aus anderen Städten zeigen durchaus, dass Aufklärungsquoten steigen, aber ein direkter Zusammenhang bleibt schwer belegbar.
Glauben Sie, dass sich Berlinerinnen und Berliner sicherer fühlen, weil es nun Messerverbotszonen gibt?
Diese Zonen gibt es, um bei der subjektiven Sicherheit anzusetzen. Die Politik will der Bevölkerung damit vermitteln: ‘Wir tun etwas’. Man muss hier ehrlich sein: Wir haben keine richtige Lösung dafür.
Es geht hier am Ende aber auch darum, wie wir uns gesellschaftlich entwickeln. Sie und ich werden abends nicht mit einem Messer rumlaufen. In anderen Familien werden Mama und Papa das vielleicht tun und entsprechend überträgt sich dieses Verhalten auf ihre Kinder.
Eine andere Sache ist noch die Verfügbarkeit. Schusswaffen sind nicht hier so leicht zu kriegen wie in den USA, aber kleine Messer eben schon. Und die reichen aus, um eine Gefahrensituation zu erstellen. Für uns heißt das also: Präventionsarbeit ist wichtig und muss früh ansetzen, am besten schon in den Schulen.
Wenn Sie morgen Berlin beraten könnten, mit welcher Maßnahme würden Sie direkt starten?
Wie gesagt, ich würde die Präventionsarbeit verstärken und an den Messerverbotszonen festhalten, aber gucken, wie ich sie sinnvoll einsetzen kann. Ich würde auch gerne Strafverfahren beschleunigen, so dass Gerichtsverfahren zeitnah nach der Tat erfolgen. Manchmal werden Täter derart zeitversetzt vorgeladen, dass sie gar nicht mehr wissen, um welchen Vorfall es eigentlich ging.
Vielen Dank für das Gespräch.