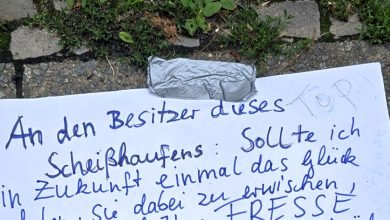Ausstellung | Bernhard Heiliger im Kunsthaus Dahlem: Weiblicher Kopf und männlicher Kragen | ABC-Z

Ausstellung | Bernhard Heiliger im Kunsthaus Dahlem
–
Weiblicher Kopf und männlicher Kragen
Mo 21.07.25 | 14:23 Uhr | Von
In der Kunst von Bildhauer Bernhard Heiliger dienten Frauen als “menschliche” Körper zur abstrakten Formfindung. Die Ausstellung “Weibliche Köpfe” reproduziert mit ihrem Fokus alte Geschlechterklischees. Von Julia Sie-Yong Fischer
Gleich beim Betreten der Ausstellung “Weibliche Köpfe” im riesigen Raum des Kunsthauses Dahlem begrüßt der “Kopf der Mutter” (1935) des Künstlers, Anna Helene Heiliger, die Besucherinnen und Besucher. Als erste Frau seines Lebens und eine der ersten Arbeiten Bernhard Heiligers chronologisch passend am Anfang.
Die aus Gips gearbeitete Plastik ist an ihrer Oberfläche voller Spuren von Arbeitsprozessen, Schlieren setzen sich von hellen Flächen in unregelmäßigen Auftrag ab. Der Gesichtsausdruck strahlt weniger Autorität als Leere und Müdigkeit aus. Durchaus nachvollziehbar, denn in ihrem Entstehungsjahr war Heiligers Mutter mit den Umständen ihrer Scheidung und ihrem Auszug mit den jüngsten Kindern Bernhard und Lieselotte konfrontiert. Als Alleinerziehende erfuhr sie finanzielle Engpässe und einen gesellschaftlichen Abstieg.
Unsichtbare Dokumentaristinnen
Doch um die Frauen aus Heiligers persönlichem Umfeld soll es in dieser Ausstellung eigentlich gar nicht gehen. Auch wenn dieser schon allein mit insgesamt vier Ehen und zwei Töchtern sicherlich viel Anlass böte. Der seit 1938 in Berlin lebende Bildhauer war Schüler des Hitlerlieblings Arno Breker und konnte über vierzig Jahre das für seinen Professor extra von den Nazis erbaute Atelier nutzen – das heutige Kunsthaus Dahlem. Seine Plastiken sind auch heute noch in ganz Berlin präsent: So steht die “Flamme” (1962-62) am Ernst-Reuter-Platz, die Aluminiumfreiplastik “Kosmos 70” (1970) hängt im Bundestag. Dennoch ist die Bernhard-Heiliger-Stiftung besorgt, sein Werk könnte in Vergessenheit geraten. Daher bemüht sie sich nun, andere neue Aspekte in Bezug auf sein Wirken vorzustellen.
In diesem Zusammenhang finden nun die Fotografinnen, die sein Werk und Leben dokumentierten, sowie seine Galeristinnen erstmals Erwähnung. So werden die Bilder der noch lebenden Fotografinnen Britta Lauer, Natalja Struve, Karin Gaa, Deidi von Schaewen und Angelika Platen in Gruppen zusammen gezeigt. Aber auch die Abzüge der bereits verstorbenen Charlotte Rohrbach, Liselotte Orgel-Köhne, Gerda Schimpf, Susann Harder und Alexandra Gräfin zu Dohna sind zu sehen. Der Fokus dabei ist ganz klar auf den Bildhauer gelegt, die Dokumentaristinnen bleiben fast ausschließlich unsichtbar.
Ein häufiges Bildmotiv: Heiliger, im Gespräch mit wichtigen Herren der Kulturszene wie Hans Scharoun oder Henry Moore in Anzügen und Zigarren bei Eröffnungen. Andere Bildnisse halten Ausstellungen als Installationsaufnahmen wie im Wilhelm-Lehmbruck-Museum fest. Mehrere Aufnahmen zeigen unterschiedliche Blickwinkel einzelner Werke im Atelier. Und einige wenige geben den Künstler in lockerer Stimmung und Fellweste privat wieder.

Frauen als menschliche Formen
Aber auch als Sujets in seiner Kunst halfen Frauen Heiliger, seinen klassischen Weg der Figuration zur Abstraktion zu finden. So begann er mit menschlichen Bildnissen, die er in seinen Darstellungen immer weiter reduzierte. “Kopf Gerda Schimpf (Kopf G. S., Frauenkopf)” (1948) besteht aus großen Flächen mit wenig Erhebungen und Vertiefungen. Die Augen sind eingeritzte kurze Linien, die Haare der Fotografin werden zu einer pilzförmigen Glocke.
Stellte er in seinen Köpfen häufig ihm real bekannte Tänzerinnen, Freundinnen und Mäzeninnen dar, können seine Körperplastiken wie die “Gelagerte (Liegende) Figur” (1949) eher mit anonymen Formspielen verglichen werden. Angeblich sollen Heiligers künstlerische Darstellung von Frauen nicht als geschlechtsspezifisch sondern universal “als Plastiken von Menschen” (laut Katalog) verstanden werden. Während in der Realität Künstlerinnen oft der Zugang zu Ressourcen und Aufmerksamkeit verwehrt wurde und wird, waren weibliche Körper als Sujet in der Kunst überrepräsentiert. Darauf machten spätestens feministische Gruppen wie die Guerilla Girls in den 1980er Jahren mit der Plakataktion “Do women have to be naked to get into the Met.Museum?” (deutsch: “Müssen Frauen nackt sein, um in das Met.Museum reinzukommen?”) bis in die Gegenwart aufmerksam.
Mittel zum Zweck
Die Idee der Ausstellung, unterschiedliche Biografien im Zusammenhang mit der Arbeit im Hintergrund der Kunst, sichtbar zu machen, ist an sich nicht verkehrt. Auch im Sinne der oft versteckten Care Arbeit, die überwiegend von Frauen übernommen wird. Jedoch zeigt bereits das Ausstellungsplakat, dass Frauen weniger als professionell ernstzunehmende Geschäftspartnerinnen Heiligers erwähnt werden. Eine scheinbar endlose Liste von Vornamen mischt echte Personen mit Titeln wie dem der Siegesgöttin Nike.
Wenn es einerseits um Frauen aus dem beruflichen Umfeld und außerdem um die Frau als Form im Werk gehen soll, wäre es dann durchaus konsequenter gewesen, Heiligers Werk auch im Kontext von ähnlich arbeitenden Bildhauerinnen wie Katharina Szelinski-Singer oder René Sintenis zu zeigen. Der Ausstellung ist es nicht anzumerken, dass Heiliger als Unterstützer besonders uneigennützig engagiert war. Es ist bekannt, dass seine Karriere durch viele Privilegien, nicht nur durch die Unterstützung Arno Brekers, Professuren, Preise oder auch dem angeblich höchsten Künstlerhonorar der Bundesgeschichte für “Kosmo 70” begleitet wurde. Dass ihn Frauen auch fotografierten oder seine Werke in Galerien verkauften, beweist noch kein emanzipatorisches Potential. Im Gegenteil: Dass Körperdarstellungen für ihn vor allem Frauenkörper waren, lässt auf ein sehr konventionell rückständiges Frauenbild schließen. So bleibt der Fokus der Ausstellung eine seltsame Farce, die Geschlechterkarte nur deshalb zu spielen um den männlichen Künstler als Genie zu manifestieren.

Bernhard Heiliger: “Die weiblichen Köpfe” vom 21.07. bis 26.10.2025 im Kunsthaus Dahlem, Käuzchensteig 12 in 14195 Berlin