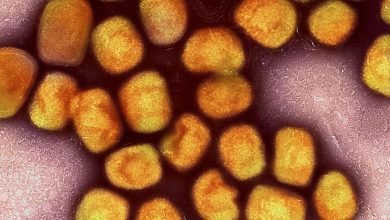Ein Präparator über staunenswerte Natur: „Ratte, Fuchs und Waschbär überleben uns locker“ | ABC-Z

taz: Herr Blumenstein, als was verstehen Sie sich?
Christian Blumenstein: Ich bin Facharbeiter für zoologische Präparation und Naturkundler, aber ich sage immer wissenschaftlicher Kunsthandwerker. Da steckt eigentlich alles drin.
taz: Sie arbeiten seit 40 Jahren im Naturkundemuseum Potsdam. Wie viele der Exponate sind durch Ihre Hände gegangen?
Blumenstein: Viele tausend Objekte. Von den Präparaten, die wir ausgestellt haben, sind 80, eher 90 Prozent meine Arbeiten. Vom Eis- und Braunbären über den Rothirsch, das Wisentkälbchen bis zur Maus und Ameise. Wir haben ja auch eine große Käfer- und Insektensammlung. Die Vögel sind fast durchweg von mir, die Greifvögel, Großtrappen und Kraniche. Auch die Landschaften in den Vitrinen habe ich meistens mit einem Kollegen zusammen gebaut.
taz: Vor dem Gespräch haben Sie darum gebeten, nicht von Ausstopfen zu sprechen. Warum sind Sie da empfindlich?
Blumenstein: Das ist ein despektierlicher Begriff. Dem Prozess der Präparation und dem künstlerischen Wert wird das in keinster Weise gerecht. Vor Hunderten von Jahren, als die Seefahrer die ersten Häute von tropischen Tieren mitbrachten, hat man das Fell bis auf die Körperöffnungen zugenäht und durch die Öffnungen ausgestopft. Dementsprechend sahen die Tiere dann aus, aber man wusste es damals nicht besser.
Im Interview: Christian Blumenstein
Der Mensch
Christian Blumenstein wurde 1968 in Wolfen/DDR geboren, als Einjähriger kam er nach Potsdam, wo er heute noch lebt. Seine Eltern waren Forstfachleute. Nach der Polytechnischen Oberschule machte er eine Lehre als Facharbeiter für zoologische Präparation. Im Naturkundemuseum Potsdam, wo er immer noch tätig ist, war er schon Schülerpraktikant. Er hat zahlreiche Preise gewonnen für seine Präparationen.
Das Museum
In seiner Dauerausstellung zeigt das Naturkundemuseum Potsdam vom kleinen Marienkäfer bis zum großen Braunbären die heimische Tierwelt, in den Sonderausstellungen werden auch überregionale Themen aufgegriffen. Aktuell sind das „Tiere im Polarlicht“.
taz: Wie macht man das heute?
Blumenstein: Man zieht das Fell ab und baut den Körper aus Kunststoff, in der Regel PU-Schaum, nach. Das ganze nennt sich Dermoplastik oder Taxidermie.
taz: Das machen Sie alles hier im Museum?
Blumenstein: Na klar. Für große Tiere haben wir einen Flaschenzug und eine sehr gute Lüftungsanlage, wenn es mal etwas strenger riecht. Die Fleischabfälle werden von einer Fachfirma entsorgt, interessante Knochen kommen in die wissenschaftliche Sammlung. In dem Schaumkörper werden anatomisch punktgenau die Gelenke markiert, erst dann wird das Fell über den Körper gebracht.
taz: Wie muss man sich das vorstellen?
Blumenstein: Das Fell muss genau an der Stelle sitzen, wo es auch am Originalkörper gesessen hat. Man kann es am besten so erklären: Wenn ich zum Schneider gehe, lasse ich mir auf meinen Leib eine Jacke schneidern. Wenn ich aber erst die Jacke habe, muss ich den Leib da rein projizieren, also ich muss andersrum denken. Dann kommt die entscheidende Phase: Das sogenannte Aufstellen.
taz: Jetzt kommt die Kunst ins Spiel?
Blumenstein: Sagen wir, der technisch-kreative Akt. Wenn das trockengeföhnte, plusterige Tier auf meinem Schraubstock sitzt und ich die Haltung festlege: sitzen, fliegen, liegen, Kopf links, Kopf rechts, eingezogen, gestreckt. Wenn ich die Augen aus Glas einsetze. Wie sollen sie gucken? Jede Vogelart hat andere Augen. Ein Kranich hat 14 Millimeter Rot. Ein Uhu hat 24 Orange-Rot. Ein Steinkauz hat 10 Millimeter Schwefelgelb.
taz: Wie viele Tiere haben Sie im Museum aktuell im Gefrierschrank?
Blumenstein: Wir haben circa tausend Tiere im Keller im Frost. Ich hätte heute Arbeit für 30 Jahre, wenn ich morgen nichts mehr neu reinbekäme.
taz: Die Tiere stammen alle aus Brandenburg?
Blumenstein: Ja. Wir haben ein großes Netzwerk aufgebaut zu den Naturschutzstationen, Biosphärenreservaten, Waldläufern, Rangern, Ornithologen, Anglern und Jägern. Wenn ein totes Tier gefunden wird, bekommen wir Bescheid.
taz: Lehnen Sie oft etwas ab?
Blumenstein: Kaum. Selbst wenn das Tier verdorben ist, kann man noch den Schädel nehmen. Man kann eine DNA-Probe nehmen, man kann zumindest die Daten verwerten für die Statistik. Wir haben eine große Datenbank. Ein Museum wächst durch seine Sammlungen. Inzwischen haben wir weit über eine halbe Million Objekte, das meiste davon in den wissenschaftlichen Depots. Bei Schenkungen von Insektensammlungen bekommt man ja schnell mal 10.000 Falter.
taz: Was wollen Sie mit dem ganzen Material?
Wir sind das naturkundliche Gedächtnis Brandenburgs. Wir dokumentieren die Veränderung der Arten, den Artenschwund
Blumenstein: Wir sind das naturkundliche Gedächtnis Brandenburgs. Wir dokumentieren die Veränderung der Arten, den Artenschwund. Die Zeit des Naturkundemuseums Potsdam reicht bis zum Gründungsdatum 1909 zurück, leider sind durch die Brände 1945 bei Kriegsende viele Sachen zerstört worden. Die neue Sammlung beginnt 1956. Die Zusammensetzung der Tierwelt war in den 60er Jahren eine ganz andere als heute. Um das abzubilden, zu dokumentieren, reichen keine Fotos. Da brauche ich Objekte.
taz: Aber doch nicht doppelt und dreifach.
Blumenstein: Wir werden das häufig gefragt: Was wollt ihr mit 300 Wolfsschädeln? Eine Art hat Männchen, Weibchen, Jungtier. Es hat ein Winterfell und ein Sommerfell. Vögel haben ein Jugendkleid und ein Alterskleid, es gibt die Mauser. Das fächert sich sofort auf und man möchte alles erhalten. Wenn es in der Natur eine Trendwende gibt, hat man das Material. In einer Gemäldegalerie fragt einen doch auch keiner, wozu brauchst du 50 Monets, wenn du schon 49 hast? Weil es ein anderes Bild ist! Und es ist auch ein anderes Tier! Aus einer anderen Zeit!
taz: Wie ist es um die Artenvielfalt in Brandenburg bestellt?
Blumenstein: Kolkrabe und Seeadler galten in den 60er Jahren als fast ausgestorben. Heute sind sie wieder dicke da. Bis in die Nullerjahre gab es keine Wölfe in Brandenburg, jetzt sind die Wölfe da. Aber wir wissen, dass manche Lebensräume arg in Bedrängnis geraten sind. Da wird immer weniger an toten Tieren bei uns reinkommen, wir jagen ja nicht, wir sind auf Totfunde angewiesen.
taz: Um welche Arten sorgen Sie sich zum Beispiel?
Blumenstein: Der Schwarzstorch wird immer seltener. Auch bei den Wiesenbrütern und Moortieren gibt es große Veränderungen. Wenn die Wiesen trocken sind oder überdüngt oder nur noch Maisäcker – dann kriege ich eben keine Schnepfenvögel mehr.
taz: Ziehen Sie auch privat mit einem Fernglas durch Felder, Wiesen und Wälder?
Blumenstein: Natürlich! Ich bin auch Naturfotograf. Feierabend heißt bei mir nicht Schluss. Und wenn ich mit dem Kombi zum Fotografieren unterwegs bin und ich finde Steine oder sonst was Besonderes, was in die Ausstellung passen könnte, packe ich das natürlich ein. Ich habe beim Autofahren auch immer das rechte Auge auf dem Seitenstreifen. Nennt sich Präparatoren-Krankheit.
taz: Also ständig auf der Suche nach totgefahrenen Tieren?
Blumenstein: Klar doch. Handschuhe und Tüte habe ich immer dabei. Oder gleich den Alkoholkanister, wenn eine Schlange anfällt. Wenn er breit gefahren ist, lasse ich einen Fuchs aber auch mal liegen.
taz: Sie sind zu DDR-Zeiten in Potsdam aufgewachsen. Wie sind Sie geworden, was Sie sind?
Blumenstein: Meine Eltern waren Forstfachleute, mein Großvater war Lehrer und Naturkundler. Wenn er geschlachtet hat, hat er das Kaninchen mit den Läufen ans Scheunentor gehängt und ihm fachmännisch das Fell über die Ohren gezogen. Und dann hatte ich noch einen alten Biolehrer in der Schule, der war Imker.
taz: Das waren Ihre Lehrmeister?
Blumenstein: Die haben mich eigentlich dazu gebracht. Schon als Kind bin ich mit Kescher und Sammelglas durch die Wiesen und hab Kohlweißlinge und so Zeug gefangen. Präparieren kam dann über die Praktika hier im Naturkundemuseum dazu. Da durfte ich bei der ersten Dauerausstellung schon ein bisschen mitmachen als Schülerpraktikant.
taz: Die Ausbildungsstelle am Museum wurde eigens für Sie geschaffen.
Blumenstein: Ja, weil ich offensichtlich ganz gut einschlug. In der ganzen DDR waren wir damals sechs Lehrlinge für zoologische Präparation. Zweimal Jena, zweimal Berlin, einmal Potsdam und einmal Stralsund. Heute würde man sagen Orchideen-Beruf. Unsere Ausbildung fand am Naturkundemuseum Berlin statt und meine darüber hinaus am Potsdamer Museum. Wir Lehrlinge konnten auch an den Vorlesungen der Biologen teilnehmen. Potsdam und Berlin sind ja Universitätsstandorte.
taz: Was waren Sie für ein Jugendlicher?
Blumenstein: Das war eine komische Melange. Ich war ein guter Schüler, manchmal Klassenprimus, ich war Junger Sanitäter, Gründungsmitglied der Fachgruppe Entomologie Potsdam. Ich war eigentlich immer auf Achse mit Mutters Fahrrad – später auf der Simson – mit Sieb und Glas zum Tümpel. Gleichzeitig war ich aber auch Punk. Auf Punkmusik stehe ich heute noch. Harter Punk möglichst.
taz: Von welchem Alter sprechen wir?
Blumenstein: In der 8. Klasse ging das los. Da ist aus dem zarten Jungen auf einmal ein Querulant geworden. Man geriet aneinander im Unterricht. Wir waren keine Westfernsehgucker im Sinne von nur einseitig, wir waren beidseitig informiert. Aber diese ganze Lügerei in der DDR hat uns angekotzt. Aldi-Tüten mussten wir auf links drehen, damit man nicht sah, dass die aus dem Westen sind. Bei Studienfahrten nach Prag bist du nicht in die Disco gekommen, weil du kein Westgeld hattest. Mit unseren Aluchips waren wir in unseren sogenannten Bruderländern Bürger zweiter Klasse. Aber wir haben unsere Mädchen trotzdem gekriegt! (lacht)
taz: Auch schwarze Klamotten getragen?
Blumenstein: Na klar, abgeschnittene Handschuhe, Kopf ein bisschen frei rasiert. Aber nie ein Tattoo und nie einen Ohrring. Ich hätte mir in der Schule damit einiges versaut. Ich glaube, dass ich so richtig nie was anbrennen lassen wollte, obwohl ich überzeugt war, dass hier alles mies läuft. Es ist auch vorgekommen, dass ich von der Polizei von der Straße weggeschnappt wurde und die halbe Nacht von einem Schäferhund bewacht in einer Turnhalle verbringen musste.
taz: Wie war das 1989 für Sie, als die Mauer fiel?
Blumenstein: Als Ossi mit 21 war man gut entwickelt. Ich bin froh, dass ich in beiden Systemen gelebt habe, beide Seiten zu kennen, ist ein Zugewinn. Die Wende hat bewirkt, dass ich mir alles erfüllen konnte, was ich will, bis heute.
taz: Was steht ganz oben auf der Liste?
Blumenstein: Die Welt kennenlernen. Als Erstes habe ich 1990 meinem Präparatorenmeister den Trabi abgekauft, eine Limousine in Spermaweiß …
taz: … wie bitte?
Blumenstein: In Papyrus, wie es in der Zulassung steht (lacht). Und damit bin ich dann mit meinem besten Freund in die Alpen gefahren. Von meinen ersten beiden Gehältern in Westmark habe ich mir einen Kassettenrecorder gekauft, den habe ich heute noch.
taz: Wie viel von der Welt haben Sie inzwischen gesehen?
Blumenstein: Ich liebe weite Landschaften. Gebirge mache ich nicht mehr. Knie kaputt. Savannen, Wüsten, auch offene Kulturlandschaften sind für mich perfekt! Ich muss weit gucken können. Ich bin in Europa rumgekommen. Ich war dreimal in Namibia, Botswana, Südafrika. Ich war in Costa Rica im Regenwald, in Alaska, in Arizona. Ich war in Kalifornien, ich war sechsmal in Florida.
taz: Aber nicht, um in der Sonne zu liegen?
Blumenstein: Nee, ich doch nicht! Ich bin auch Taucher. Und wenn da ein Strand ist, muss da auch was zu finden sein. Ich bin ein richtiger Strandwolf. In dem Plätscherwasser an der Ostsee kann ich nichts finden. Ich fahre lieber an die Nordseeküste, wo jeden Tag tote Vögel angetrieben werden.
taz: Sie haben zu Hause auch eine Gefriertruhe?
Blumenstein: Für die Urlaubsmitbringsel, na klar! (lacht)
taz: Sie sind dem Museum immer treu geblieben, obwohl Sie als Präparator viele Preise gewonnen haben, zweimal auch einen Weltmeistertitel für plastinierte Kleinsäuger. Gab es nie einen Ruf oder den Wunsch woanders hinzugehen?
Blumenstein: Ich bin hier inzwischen der Dienstälteste (lacht). Natürlich hat man mal erwogen wegzugehen, aber die Heimat ist die Heimat, die Familie ist die Familie. Und ich meine, Brandenburg liebe ich schon über alles.
taz: Was entgegnen Sie Leuten, die präparierte Tiere gruselig finden?
Blumenstein: Ich bin der Meinung, dass lebensechte Präparate Werbung für die Natur und ihren Schutz sind. Und ein Beitrag zur Volksbildung.
taz: In welchem Sinne?
Blumenstein: Kinder rufen nicht automatisch „ihh“, wenn sie vor der Vitrine mit den Ratten stehen. Sie sind beeindruckt, manche sagen sogar, „die sind aber süß“. Das „ihh“ haben sie nur von ihren Eltern gelernt.
taz: Auch die Landschaften in den Vitrinen wirken erstaunlich lebensecht. Was ist Ihr Geheimnis?
Blumenstein: Wir arbeiten hauptsächlich mit natürlichen Materialien, die wir uns draußen im Gelände zusammensuchen. Steine, Holz, Schilf, Korn, Nadeln, Äste, Bodensubstrate. Manchmal sind das busweise Ladungen. Wenn ich drei Quadratmeter Grassoden für eine Vitrine brauche, muss ich sechs holen, weil die Fläche beim Trocknen schrumpft.
taz: Einfacher Rollrasen täte es nicht?
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Blumenstein: Nein. Ich brauche die Artenvielfalt in so einer Wiese.
taz: Laufen Sie bisweilen Gefahr, sich in Details zu verlieren?
Blumenstein: In unserem Museum ist nicht so viel Platz. Bei der Gestaltung der Vitrinen ganze Lebensräume authentisch auf wenigen Quadratmetern zusammenzudrängen, ist nicht einfach. Ich will ja alles zeigen, alles schön machen und dann wird es manchmal ein bisschen voll (lacht).
taz: Welche Ihrer Vitrinen gefällt Ihnen am besten?
Blumenstein: Da muss ich jetzt schon sagen, die Kranich- und die Großtrappenvitrinen. Das sind wirklich Meisterstücke, mit meinem langjährigen Kollegen Dieter Lehmann zusammen.
taz: Balzende Trappen-Hähne, Hennen und Jungtiere stehen in der Vitrine in einer blühenden Wiesenlandschaft. Sie sind auch Mitglied im Großtrappenschutzverein. Warum engagieren Sie sich für diese Art?
Blumenstein: Dieser beeindruckende Vogel verfolgt mich seit Anbeginn eigentlich. Wir hier in Brandenburg sind die Einzigen in Deutschland, die draußen noch Großtrappen haben. Inzwischen sind wir wieder bei einer Kopfzahl von rund 300 Vögeln. Mitte der 80er Jahre waren es noch knapp 30 Tiere. Da wird es schwierig mit dem Genpool, wenn es um Reproduktion geht. Dem Feldhamster geht es ähnlich. Die Spezialisten gehen immer als Erstes den Bach runter. Die Generalisten, Ratte, Fuchs und Waschbär, überleben uns locker.
taz: Seit wann ist der Feldhamster in Brandenburg verschwunden?
Blumenstein: Ich habe 1996 noch einen Schädel gefunden in der Uckermark, ich hoffe also noch.
taz: Was gibt es da noch zu hoffen?
Blumenstein: Es ist schon vorgekommen, dass verschollene Arten wiedergekommen sind. Bei Insekten ist das manchmal so. Die große Frage ist, wie konnten die sich 50 Jahre unerkannt vermehren? Und wenn es nur noch fünf Stück gibt, wie finden die sich?
taz: Wie erklären Sie sich das?
Blumenstein: Gar nicht! Ein totales Phänomen ist das.
taz: Sie können also noch staunen über die Natur?
Blumenstein: Jeden Tag! Ob tot oder lebendig (lacht).