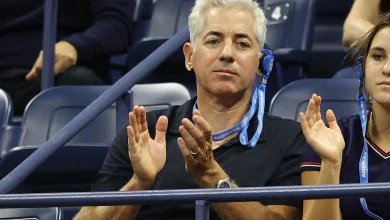E1-Rennboote setzen auf Umweltbewusstsein und Prominenz | ABC-Z

Was braucht man, um einen neuen Rennsport zu erfinden? „Leidenschaft, Kompetenz und ein Netzwerk“, sagt Rodi Basso, ein italienischer Ingenieur, der lange bei der NASA, bei Ferrari und McLaren gearbeitet hat und der jetzt Vorstandschef eines neuen Rennzirkus’ ist: E1 lautet der Markenname der Unternehmung, und dahinter steckt eine Weltcup-Wettkampfserie elektrogetriebener Rennboote. Das Kürzel verrät die Ambition: Das E soll die elektrische Umweltfreundlichkeit symbolisieren und ein wohlwollendes Image verkörpern, die 1 steht für den Anspruch, auf dem Wasser das werden zu wollen, was die Formel 1 auf Asphalt ist.
Was braucht man noch? Unter anderem Langeweile, Geld und Drohnen, wie Bassos Gründergeschichte auch beweist. Er erzählt gern, die Idee zu E1 sei in der Zeit der Corona-Pandemie geboren worden, während einer Runde „Distanz-Jogging“, die Basso mit seinem Freund Alejandro Agag in London am Ufer der Themse unternahm.
Agag ist ein früherer spanischer Politiker, Mitarbeiter und Schwiegersohn des einstigen Ministerpräsidenten Aznar, er war auch Miteigentümer des Fußballklubs Queens Park Rangers; gegenwärtig ist er Chef der Organisations- und Vermarktungsfirma Formula E Holdings, welche die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft betreut, also die Rennserie für elektrisch angetriebene Rennwagen.
„Schön schnell, aber nicht verrückt schnell“
Das Geld für die neue Idee der Beiden stammt von einem saudi-arabischen Investmentfonds, der auch die Entwicklung des Rennboot-Prototypen mitfinanzierte. Der Typen-Name des Bootes lautet ein wenig irreführend „RaceBird“ – Rennvogel. Die norwegische Boot-Designerin Sophi Horne, die ein Konzept für Tragflügelboote mit Elektroantrieb ersann, hatte zuerst an Passagier-Boote gedacht und ihre Startup-Idee SeaBird genannt. Mit Basso und Agag machte sie daraus ein keilförmiges Einsitzer-Boot, dessen Anmutung ein wenig an die Kampfjets der Star-Wars-Filme erinnert, die Tragflächen setzen seitlich an und sind dann im Bogen unter den Rumpf gebogen.
Schon bei etwa 30 Stundenkilometern hebt sich der Bootskörper aus dem Wasser, die Spitzengeschwindigkeit liegt bei rund 52 Knoten, also knapp 90 Kilometer pro Stunde. Das sei „schön schnell, aber nicht verrückt schnell“, sagt Basso, der Anfang Juli wieder nach London gekommen ist, um den Rennvogel auf der Themse zu präsentieren. Ihn leitet die Hoffnung, dass daraus demnächst ein Termin im E1 Rennkalender werden könnte: die Boote auf einer Rennstrecke mit der Tower-Bridge im Hintergrund, oder mit dem Riesenrad London Eye, oder sogar mit Big Ben.
Vorbild für einen nachhaltigen Wassertransport?
Einstweilen ist die Londoner Hafenbehörde knausrig mit Zeitfenstern und Platz. Die beiden Speedboote, die Beispiel-Bilder von der Zukunftshoffnung liefern sollen, müssen schon im Morgengrauen hinaus aufs braune Themsewasser, um dort vor dem Parlamentspalast von Westminster ein paar Runden drehen zu können. Und hier ist jetzt auch eine andere innovative Technik im Spiel – die der Kamera-Drohnen.
Ohne ihre Perspektiven und Aufnahmewinkel wäre das Wettkampf-Spektakel auf dem Wasser nur eindimensional vom Ufer aus zu verfolgen – und damit im Fernsehen und in Streaming-Diensten viel weniger gut zu vermarkten. Der E1-Techniker, der den Londoner Probelauf organisiert hat, erzählt, die Hafenverwaltung sei mit ihrem Antrag, Rennboote in den Fluss zu setzen, professionell umgegangen, es sei fünfmal aufwendiger gewesen, bei einer Handvoll Behörden die Überflug-Genehmigungen für die ferngesteuerten Kameras einzuholen.
„Nachhaltigere Zukunft des Wassertransports“
Basso und sein Organisationsteam bemühen sich, den Londoner Zwischenstopp nicht bloß als Vermarktungs-Chance erscheinen zu lassen, sondern ihn in das grüne Licht einer Umweltmission zu tauchen. Die Londoner Verkehrsbetriebe überlegten ja, wie sie den Passagierverkehr auf dem Fluss auf abgaslose Antriebe umstellen könnten, da setzten die E1-Racebirds doch positive Zeichen.
Und in der Presseinformation, die Bassos Unternehmung zu ihrem Londoner Show-Run verteilt, wird der Chef mit der Beteuerung zitiert, „unter der Oberfläche der adrenalingetriebenen E1 Rennserie liegt die Mission, den Schutz und die Wiederherstellung unserer Küstengewässer und Ökosysteme durch modernste saubere Technologien zu fördern“. Er habe die „große Hoffnung”, so Basso weiter, „dass E1 uns durch unsere Pioniertechnik in eine nachhaltigere Zukunft des Wassertransports führen wird“.
Aber er weiß selbst, dass der Umwelt-Idealismus selbst das Adrenalin und die Neugierde kaum erzeugen kann, die seine Rennserie braucht, um erfolgreich zu sein. Also berichtet er augenzwinkernd, er habe „wie jeder italienische Ingenieur“ einst unbedingt bei der Formel 1 arbeiten wollen. Da sei man aber oft an Orten und auf Rennstrecken tätig, „die nicht so schön gelegen sind“.
Mit den Rennbooten sei das ganz anders. Der Kalender der laufenden Saison – es ist das zweite Jahr für E1 – zählt die Orte Dschidda, Doha, Dubrovnik, den Lago Maggiore, Monaco, Lagos und Miami auf. Lagos sei wichtig, sagt jemand aus dem Techniker-Team treuherzig, weil die nigerianische Küstenstadt ja auch heftig von Klimawandel und steigenden Meeresspiegeln betroffen sein werde.
Wir wollen „Lifestyle am Wasser“ zelebrieren, sagt der E1-Chef und beteuert, die umweltfreundliche Technik helfe dabei: Die Elektromotoren machten keinen Lärm, die Tragflügelboote verursachten auch keine Wellen. Die Rennen könnten also ganz nah am Publikum stattfinden. Die Markierungsbojen, die den Rennkurs abgrenzen, halten übrigens kleine GPS-Empfänger und Elektromotoren in ihrer Position – sie brauchen dann keine Verankerung, die den See- oder Meeresboden schädigen könnte.
Zwei Millionen Dollar pro Teamlizenz
Die letzte Zutat, die den Erfolg der E1 befördern soll, lautet Prominenz. Aber anders als bei der Formel 1 sind auf dem Wasser nicht die Piloten die Stars – sie illustrieren eher zusätzlich die globale progressive Mission der Veranstaltung: In allen neun gemeldeten Teams wechseln sich nach jedem Rennen Männer und Frauen am Steuer ab; die 18 Piloten und Pilotinnen stammen aus 11 Nationen – und aus den verschiedensten Sportarten, von der Formel 1 über den Rallye-Sport bis hin zum Katamaran-Segeln.
Die klangvollen Namen gehören stattdessen den Eignern der einzelnen Teams. Der Tennisspieler Rafael Nadal zählt zu ihnen, der Fußballer Didier Drogba, der American-Football-Spieler Tom Brady, der indische Kricketspieler Virat Kohli und der US-amerikanische Schauspieler Will Smith. Jeder von ihnen hat für zwei Millionen Dollar eine Teamlizenz erworben, die 25 Jahre läuft; die laufenden Kosten einer Saison hält Basso je Team für etwa ebenso hoch.
„Es ist einfach die richtige Mischung“
Der Großteil der Einkünfte des Veranstalters soll aus den Fernseh-Übertragungen kommen, die E1 in eigener Regie produziert und Sendern auf der ganzen Welt anbietet. Die Sendungen sind auf jeweils zwei Stunden an den Renn-Wochenenden konzipiert; je eine Stunde für das eigentliche Renngeschehen und eine Stunde für die Vermarktung des jeweiligen Gastgeber-Ortes: „Wir präsentieren alles“, sagt Basso, „Kultur, Sehenswürdigkeiten, Wirtschaftsstandort, Immobilien.“
Die Piloten verdienen seinen Angaben nach ordentliche Gehälter von bis zu 100.000 Dollar (etwa 85.000 Euro) jährlich. Es könnte mehr werden, wenn weitere Austragungsorte im Jahreskalender markiert werden. Auch für ein paar weitere Teams wäre Platz, um die Konkurrenz zu vergrößern. Gibt es überhaupt einen richtigen Wettkampf, wenn alle buchstäblich im gleichen Rennboot sitzen?
Der Neuseeländer Micah Wilkinson, der für Team Drogba fährt, hat eine klare Meinung: „Sobald man den Helm aufgesetzt hat, geht es um Wettbewerb“, hinterher dann gehe es wieder um Kameradschaft. Und trotz der identischen Technik hätten Monteure und Piloten viel Einfluss auf das Verhalten der Boote. Sie könnten aus mehreren Antriebspropellern wählen, die Anstellwinkel der Steuer-Tragflügel im Heck spielten eine Rolle und der Kurs, der nach bestimmten Regeln individuell gefahren werden kann. Chef Basso sagt: „Es ist einfach die richtige Mischung aus Risiko und Unvorhersehbarkeit.“